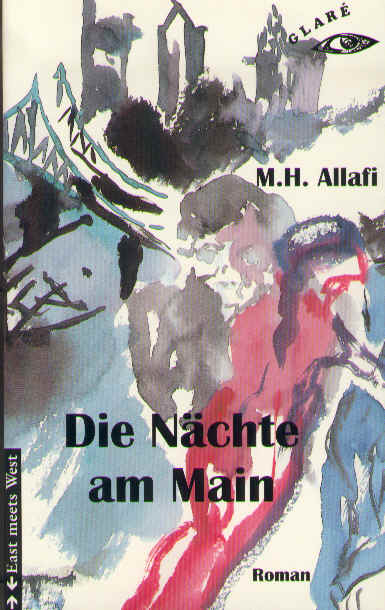 M.H.
Allafi
M.H.
AllafiDie Nächte am Main
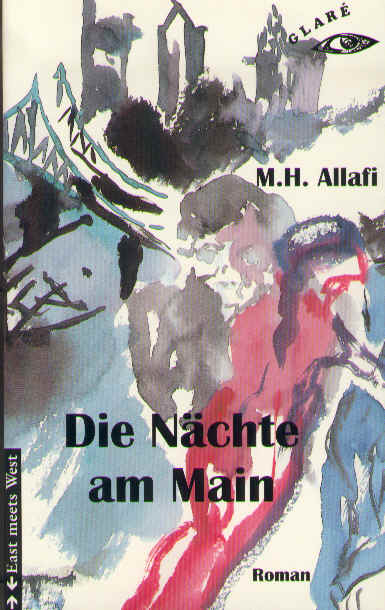 M.H.
Allafi
M.H.
Allafi
Die Nächte am Main
East meets West 2
Leseprobe:
...
Als Hassan ankam, saß Gabriela in der Küche und rauchte. Sie sah niedergeschlagen und traurig aus. Das Telefon stand vor ihr auf dem Tisch, als hätte sie sich, seit sie bei ihm angerufen hatte, nicht von der Stellte bewegt. Sie bemerkte Hassans Kommen nicht. Hassan sagte: „Hallo!“
Gabriela schrak zusammen. Während Hassan seinen Schlüsselbund in die Hosentasche steckte, sagte er lachend, um die bedrückende Situation ein bißchen zu entspannen: „Abgemacht ist abgemacht. Du hast gesagt, ich soll nicht klingeln, sondern einfach aufschließen und ‘reinkommen.“
Hassan bückte sich und küßte Gabriela auf den Mund. Gabriela lachte nicht, sie war nicht, wie sie sonst immer war.
„Na, nun sag mal, was ist mit Mechthild passiert?“ fragte Hassan, während er ihr sanft über den Nacken fuhr. „Ist Hans nicht zu Hause?“
Hans war zu Hause, er saß in seinem Zimmer lauschte dem Rauschen seines Computers. Er war in das Studium des Dateiverzeichnisses versunken: „Ich_klage_an!“ Darunter hatte er 250 Dateien mit jeweils mindestens 58,8 GB gespeichert. Eine riesige Anklageschrift beziehungsweise Anklagedateien, die Hans im Laufe vieler Jahre gesammelt hatte. Wen er anklagen wollte, war bei Gott unklar, meinte Gabriela. Er schrieb: „Die Kapitalisten, die Sozialisten, die Kommunisten, die Christen und die Islamisten.“
Obwohl Hans sehr klug war, hatte er offensichtlich noch nicht ganz von diesen Begriffen Abschied genommen. Mußte man, konnte man von ihnen Abschied nehmen, oder waren sie vielmehr unter den jetzigen Umständen unerklärlich? Niemand wußte eine ehrliche Antwort auf diese Frage. Man konnte höchstens alles verdrängen. Aber Hassan lachte immer, wenn Hans sich so aufregte. Er sagte, Hans könne seine Liste beliebig erweitern, um Egoisten, Sado-Masochisten, Eurozentristen, Rassisten, Sexisten...
Die letzte Datei, die Hans heute gespeichert hatte, hieß Mechthild, wie jene Frau, die sich nun weiß und durchsichtig kleidete, und die einen weißen Stuhl am Straßenrand ziemlich genau vor ihrem Haus aufgestellt hatte, mitten auf einem markierten Parkplatz. Dort saß sie. Sie rauchte, sie lachte und weinte abwechselnd. Das waren in der letzten Zeit die Beschäftigungen einer Frau, die wieder einmal das Leben verlassen hatte.
Passanten gingen vorbei, die meisten nahmen keinerlei Notiz von ihr. Nur manche schauten sie bedauernd, andere haßerfüllt an. Hin und wieder wurde ein Autofahrer mit zerrütteten Nerven auf der Suche nach einem Parkplatz auf sie aufmerksam, und empört über sie, gestikulierte er voller Zorn wie wild hinter seinem Steuer, bohrte wütend seinen Finger in den Kopf und fluchte. Sie war ja verflucht, was kümmerten sie die Beschimpfungen dieses oder jenes erregten Autofahrers?
Die Menschen waren bunt gekleidet, sie liefen frei herum, ohne Aufsicht. Aber niemand bekundete ihr sein Beileid. Der Teufel wußte, was mit ihr geschehen war. Auf einmal wußte sie es selbst auch nicht mehr. Vom lieben Gott war nichts zu erwarten, Gott hatte den Menschen hier viele schöne Sachen beschert, nun waren sie daran, ihre Aufgabe richtig zu erfüllen.
Gott war eine weitere große Lüge in der Geschichte der Menschheit, meinte Hans. Gabriela und Hassan bestätigten es.
Die Verschiedenheit zwischen der nächtlichen schwarzen Gasse dort und der hellen, farbenfrohen Straße hier vereinigten sich in einem Punkt, in Mechthilds Einsamkeit.
Einsamkeit?
Sie war doch nicht einsam, Tausende Menschen wimmelten um sie herum. Freundinnen und Freunde hatte sie auch. Die besuchten sie sogar, seit sie sich entschlossen hatte, jeden Tag vom Morgen bis zum Abend in ihrem weißen durchsichtigen Kleid auf dem weißen Stuhl vor dem Haus zu sitzen. Sie sprach jedoch mit niemandem, oder sie wollte niemanden erkennen? Spielte sie etwa eine späte Braut, die auf ihren Bräutigam wartete?
Nicht einer erfuhr, weshalb sie das tat. Gerüchte verbreiteten sich in der ganzen Stadt, die Zeitungen berichteten über sie. Anfangs kämpften die Journalisten um jede Neuigkeit über die seltsame Frau. Am Ende stellte sich heraus, daß sie so lange warten würde, bis die Erde erbebte, bis die Menschen wachgerüttelt und zu sich gekommen waren.
Die Menschen fragten sich und tuschelten, was sie wohl in diesem dünnen Kleid machen würde, wenn der Winter kam. Sie würde sich erkälten, und wenn sie weiter beharrlich hier sitzen bliebe, würde sie innerhalb kurzer Zeit in Totenbett liegen. Dann würde die Straße, die Stadt aufatmen. Es waren auch böswillige Bemerkungen zu vernehmen. Das habe sie verdient, sie hätte sich schließlich nicht von dem Kanacken ein Kind machen lassen müssen. Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank, daß solche Menschen nichts zu sagen hatten und nun zumindest an den Rand der Zivilisation gepreßt waren. Es war auch gut so. Sonst könnte man es absolut nicht aushalten, und Mechthild wäre auf der Stelle gesteinigt worden. Einmal musste sie schließlich auch Glück haben.
Eines war in diesem Wirrwarr aufgefallen, daß Frau Thomas Mechthild nicht nur mit Brot, Schinken und Kaffee versorgte, sondern sie auch liebevoll pflegte. Das schien rätselhaft. Aber Hans recherchierte mit seinem ganzen journalistischen Wissen und seiner Erfahrung. Es stellte sich heraus, daß Mechthild Frau Thomas’ Tochter war.
So, so! Ihretwegen mochte Frau Thomas nicht verreisen, sie haßte es. Als damals ihre einzige Tochter Mechthild mit ihrem Mann Deutschland verlassen hatte, war Frau Thomas zutiefst schockiert gewesen. Und sie hatte sich entschlossen, nie wegzufahren.
So, so! Jeder hat seine eigenen Gründe, nicht zu verreisen.
Hans selbst hatte seinen Grund aus dem Arbeitsamt mitgebracht, als er sich entschloß, Deutschland nie zu verlassen, weil ihm gegenüber im Ausland alle deutschenfreundlich waren. Er meinte nicht die Wirte oder Hotelbesitzer, oder die Händler, die ihm irgendwelche exotischen Ware andrehen wollten, sondern die Menschen, einfache Menschen wie du und ich. Im Gegensatz dazu wurde in Deutschland die Ausländerfeindlichkeit zu einem Bestandteil des täglichen Lebens.
Ausländerfeindlichkeit?
Ein neuer Begriff, den man nicht erklären kann.
Hans konnte es nicht ertragen und all diese Dinge mit seinem Gewissen in Einklang bringen. Gabriela und Hassan fuhren nach seinem Beschluß nur ein einziges Mal ins Ausland, dann solidarisierten sich mit ihm.
So, so! Jeder wollte sein Gewissen beruhigen.
Es war traurig, konnte man wohl meinen. Frau Thomas hatte ihre Tochter zurück, pflegebedürftig zwar, genau wie damals, als sie noch ein Kind war. Damals wußte sie, daß sie es großziehen mußte. Nun war sie verzweifelt. Sie mußte für ihre Backstube eine weitere Aushilfe einstellen. Frau Thomas war nicht eine, die ihre Tochter ins Sanatorium geschickt hätte. Sollte sie sie etwa bis zum Tode pflegen? O je, wie labil ist der Mensch!
Gabriela rauchte ihre Zigarette zu Ende. Immer noch schweigend saß sie auf ihrem Platz, Hassan saß ihr genau gegenüber. „Also, willst du nicht sagen, was mit Mechthild passiert ist?“ fragte er noch einmal.
„Ihr Sohn hat sich erhängt!“ schrie Gabriela.
„Ihr Sohn hat sich erhängt“, wiederholte Hassan. „Warum hat er das getan?“
„Niemand weiß, warum! Beziehungsweise, ich weiß es nicht. Es ist auch nicht wichtig, warum“, erwiderte Gabriela unfreundlich.
„Hast du bei ihr angerufen?“
Gabriela hatte seit Jahren nicht mehr bei ihr angerufen. Ab und zu hatte Mechthild sich gemeldet.
„Nein! Ich habe es in der Zeitung gelesen“, sie warf die Zeitung vor Hassan auf den Tisch.
„Wollen wir sie jetzt besuchen und unser Beileid aussprechen?“ fragte Hassan, ohne einen Blick auf die Zeitung zu werfen.
„Nein!“
„Warum nicht, bei uns ist es üblich, ich meine in Iran, nach so einem Unglück, geht man und tröstet die Familie der Verstorbenen.“
„Ist mir scheißegal, was in Iran üblich ist! Sie ist selbst durchgedreht, völlig verrückt!“
Zum ersten Mal sprach Gabriela in einem solchen Ton. Hassan fand es seltsam, dieses Benehmen von ihr, er redete nicht mehr und fing an, die Zeitung zu lesen. Gabriela ließ ihn die ganze Zeit nicht aus den Augen. Sie fand es selbst gemein, wie sie mit Hassan umging. ‘Was hat Hassan mit der ganzen Sache zu tun?’ dachte sie.
Hassan legte die Zeitung beiseite, zündete sich eine Zigarette an und fragte vorsichtig: „Meinst du, wir können nicht irgend etwas für sie tun?“
„Nein, Hassan, es tut mir leid, daß ich so heftig reagiert habe. Ich bin zu ihr gegangen, sie hat mich nicht einmal erkannt. Ich habe bei ein paar Leuten angerufen, ich meine, bei ihren Freunden, und die haben mir erzählte, daß ihr Sohn in letzter Zeit viel nach seinem Vater gefragt habe und unter starken Depressionen litt. Ich weiß selbst nicht, warum ich mich so betroffen fühle.“
Hassan wurde nachdenklich. Er musterte Gabriela und ahnte, daß sie ihn mit Iran identifizierte, und zwar mit einem Iran, in dem das Schicksal von Mechthild und ihrem Sohn besiegelt worden war. In seinem Gedächtnis begann Gabrielas Porträt zu verschwimmen, und er merkte, hier brillierte die Allgemeinheit. Er lachte bitter.
Er mußte an die iranischen Jungen und Mädchen denken, die er kannte, die dasselbe Schicksal wie Mechthilds Sohn hatten. Er dachte, so etwas wäre ein typisches Symptom für iranische Familien in der Fremde. Von Gabriela hatte er mehr erwartet. Daß sie die Dinge so vereinfacht und flach beurteilte, enttäuschte ihn. Hatte sie etwa einen Sündenbock gesucht, und dabei ihn gefunden? Wollte sie ihren Zorn an ihm auslassen? Er stand auf. Gabriela dachte, er wollte gehen. „Ihr hättet euch mehr um Mechthild und ihren Sohn kümmern sollen. Mit mir hat das nichts zu tun, was sie in Iran erlebt hat“, sagte Hassan.
Er ging zum Fenster und schaute auf die Straße.
Iran? Wo war Iran? Ein weit entferntes Feld, auf dem einer geboren war und viele gestorben? War er nicht ein Märchen, eine traurige Geschichte, in deren Verlauf ein Vater starb und sein Sohn verschwand und die Mutter weinte, bis sie auch nicht mehr existierte. Doch Iran war dort, wo Kain den Abel erschlagen hatte, wo Hassan kulturell enteignet worden und aus der Geschichte ausgewandert war. So viele Abels und so viele Kains? So viele Auswanderer?
Iran, das waren Hunderttausende Bilder in den Köpfen der in der Fremde lebenden Iraner, die dort starben. Iran starb jeden Tag, erhängte sich, drehte durch, verzweifelte. „Was ganz weit weg den Namen Iran trägt, das hat mit mir etwas zu tun?“ flüsterte Hassan in sich hinein.
Gabriela stand auf und trat ebenfalls zum Fenster, wo Hassan nun mit dem Rücken zur Straße stand. Während sie versuchte, seinen Hals mit ihren Händen zu umklammern, sagte sie: „Es tut mir leid, Hassan, es war nicht so gemeint.“
Hassan wies ihre Hände ab: „Nein, Gabriela, ich bin nicht sauer auf dich. Ich habe keinen Grund dafür. Du bist so gut, daß ich nicht einen Moment lang daran gedacht habe, daß du gemein sein könntest. Das ist das Problem des Menschen.“
Und der Mensch lief auf der Straße. Er war alt und sah erschöpft und einsam aus. Er schob einen gestohlenen Einkaufswagen vor sich her und ging von Haus zu Haus. Er verteilte Werbezettel, gebrechlich, zitternd aber ordentlich und gelassen ging er dieser Arbeit nach. War das Fleiß, was dieser alte Mann demonstrierte, oder ein trauriges Schauspiel? Tat er es allein des Geldes wegen, oder wollte er nicht in seiner Wohnung allein sein und überbrachte deshalb den Haushalten die Botschaft der Großmärkte, damit sie fröhlich lebten. Lebten sie etwa fröhlich?
Hans kam aus seinem Zimmer und schrie: „Ich klage an!“
„Hoffentlich nicht mich!“ sagte Hassan.
Hans nahm es nicht wahr. Er tätschelte Hassans Schulter. „Komm, trinken wir eine Flasche Wein. Die Welt ist so beschissen, Hassan!“
„Ich weiß, Hans. Ich möchte gehen. Übrigens habe ich noch nie so früh am Tag, vor der Abenddämmerung, Wein getrunken.“
„Der Abend dämmert in mir, Hassan. Du bist doch gerade erst gekommen. Hast du etwa was Wichtiges zu tun?“
„Ja, sehr wichtig! Ich habe gar nichts zu tun!“ sagte Hassan.
Dann lachte er kopfschüttelnd auf. „Ich wollte an den Main gehen und ein bißchen hin und her laufen. Vor vielen Jahren bin ich, wenn ich traurig war, auf den Friedhof gegangen, und während ich dort lief, las ich die Inschriften der Grabsteine, dann ging ich erleichtert nach Hause. Seit ich in Deutschland bin, gehe ich an den Main.“
Der Main rauschte nicht und schäumte nicht. Er schien tot zu sein. Das Leben ging weiter. Gabriela in der Mitte, Hans zur Rechten, Hassan zur Linken, schritten sie Hand in Hand durch die Nacht. Unter ihren Schritten knirschten die Kieselsteine. Sie sprachen nicht. Knirschen und Stille hatten die Nacht fest im Griff. Kieselsteine am Mainufer? Oh, es waren Schottersteine. Der Staat sorgte für seine Bürger. Nein, der Staat sorgte dafür, dass es knirschte, dass es ratterte.
Der Staat schwamm und flog, landete am Persischen Golf, in den Bergen Kurdistans, am Rande der saudi-arabischen Wüste, wo es knallte, wo es ratterte. Die Nation jubelte. Kinder und Frauen schrien in Bagdad, die Bomben waren so grauenhaft laut, man konnte ihre Schreie nicht hören. Es war nicht wie vor dem Fernsehen, der Ton ließ sich nicht regulieren.
Gabriela in der Mitte, Hassan zur Linken, Hans zur Rechten, zogen sie durch die Stadt und schrien aus voller Kehle: „Wir klagen an!“
Ihnen fiel nichts Besseres ein. Sie wurden ausgelacht und für verrückt erklärt. Die Stadt war nicht mehr bewohnbar, es tauchten immer mehr Leute wie Mechthild auf, dazu kamen solche wie diese drei, meinte die Bevölkerung. Es kam nie Gutes dabei heraus, wenn die Bevölkerung zu meinen anfing.
Die Weinflasche war leer. Die beiden Männer waren leicht berauscht. Gabriela hatte nichts mitgetrunken. Sie hatte sich in ihr Zimmer zurückgezogen und las. Gabriela hatte einfach keine Lust auf Trinken. Nein, es war nicht wegen ihrer Gesundheit. Gesund wollte sie schon sein. Der Tod war für sie kein Thema als solches. Angst vor dem Tod hatte sie nicht, aber auf des Messers Schneide wollte sie nicht balancieren.
Hassan war damals auf den Friedhof gegangen, um die Absurdität der Gier im Leben zu spüren und sich möglichst davon fernzuhalten. Gabriela besuchte aus dem gleichen Grund historische Museen und Ausstellungen, die die Werke von in den vergangenen Jahrhunderten lebenden Künstlern zeigten. Das Leben ist ein Gehen und Vergehen, wir vergessen das zu oft, meinten beide.
Gabriela kam in die Küche zurück. Nun hatten alle drei Hunger. Niemand hatte Lust, zu kochen oder irgend etwas vorzubereiten. Man beschloß, das Abendessen in einem Restaurant einzunehmen. Mit einem Mal wollte Hassan wissen, warum man Mechthild nicht besuchen und ihr eventuell behilflich sein konnte. Gabriela wiederholte, daß sie durchgedreht sei und niemanden erkenne. Zusammenhanglos sagte Hans: „Ich habe recherchiert, sie ist die Tochter von Frau Thomas, der Bäckerin.“
Gabriela machte große Augen: „Du hättest auch mich fragen können, ich hätte es dir gleich gesagt. Dann hättest du dir die Mühe sparen können.“
Es wurde nicht weiter gesprochen. Sie hatten Zeit bis zum Abendessen, sie einigten sich darauf, auf dem Weg zum Restaurant kurz bei Mechthild vorbeischauen, Hassan mochte sie gern zumindest in diesem Zustand sehen.
Sie waren da. Glück hatten sie, Mechthild hatte noch nicht Feierabend gemacht. Alle drei gingen auf sie zu. Mechthild schaute ihnen in die Augen und schrie auf: „Schwarz, weiß, weiß!“
Sie zeigte in der Reihenfolge auf Hassan, Gabriela und Hans. Sie lachte wie ein Kind, genauso weinte sie auch. Hassan sprach sie an, aber sie weinte und lachte, in regelmäßigen Abständen. Hassan war verzweifelt, betroffen. Gabriela schaute ihn rechthaberisch an.
Es dunkelte. Sie gingen weiter.
Sie waren noch nicht lange fort, als Frau Thomas kam und sich vorsichtig Mechthild näherte, sie strich ihr sanft über die Haare und flüsterte ihr etwas zu. Mechthild lächelte und erhob sich von dem Stuhl. Frau Thomas nahm den Stuhl. Sie lief voran, Mechthild folgte ihr. Sie liebte Schokoladenpudding.
Nach dem Abendessen in einem bürgerlichen Restaurant verschwand Hans, ohne den anderen Bescheid zu sagen. Es wunderte Hassan nicht mehr, es gehörte seit vielen Jahren zu dem Bestand ihrer Freundschaft. In einer Kneipe mußte man immer damit rechnen, daß Hans eventuell auf dem Weg zur Toilette verschwand. Gabriela und Hassan verließen das Restaurant. Hand in Hand schlenderten sie durch die Straßen der Stadt. Ab und zu blieben sie stehen, tauschten ein Küßchen, aber nicht sehr innig. „Ich fühle mich angegriffen von diesem Alltag in diesem Deutschland“, flüsterte Gabriela.
„Ich fühle mich losgelöst in diesem Deutschland. Ich fühle mich an keinen Ort gebunden. Ich bin irgendwie verdrossen. Mein Bindeglied zur Welt bist nur noch du.“
„Das klingt kindisch, Hassan!“
„Vielleicht bin ich ein Kind geblieben?“
„Wir sind alle irgendwie kindisch.“
„Ich sehe kein bewegendes Motiv in meinem Leben. Ich bin ein Wanderer, auf der Suche nach dem Sinn. Gefunden habe ich viel, aber nichts davon ist übrig geblieben.“
„Gefährliche Gedanken hast du, Hassan.“
„Ich trage die Gefahr in mir, die Gefahr für mich. Das ist es, was mich beruhigt. Ich bin ein Mensch ohne Verantwortung.“
„Verantwortungslos bist du aber nicht, Hassan.“
„Das weiß ich nicht, es kommt darauf an, wie man es definiert, Gabriela. Ich könnte mich als Mensch mit anderen solidarisch erklären, aber ich trage keine Verantwortung. Ob jemand meine Solidarität braucht, das ist die andere Frage.“
„Ich glaube, solche Diskussionen haben kein Ende, lassen wir es, Hassan.“
„Es gibt auch kein Ende.“
„Wollen wir nach Hause gehen?“ fragte Gabriela.
Und sie gingen nach Hause.
Hans zog von Kneipe zu Kneipe, bis die letzte von ihnen schloß und er sie als letzter Gast verließ. Er lief zum Main. Dort drehte er aufgeregt eine Runde, dann setzte er sich. Der Main war unruhig, er rauschte heftig.
Gabriela lag nackt auf der Couch. Sie stöhnte und keuchte, sie schrie vor Schmerzen, angenehmen Schmerzen. Sie war naßgeschwitzt, ihr Körper war wie ein Meer mit stillen Wellen, er ringelte sich. Die Schweißtropfen fanden sich zusammen und flossen wie ein Bach um ihre beiden Brüste. Die beiden Wasserzweige trafen auf ihrem Bauch zusammen und trennten sich wieder. Als sie ihren Nabel umkreist hatten, wurden sie erneut eins. Dann strömten sie wie ein gewaltiger Wasserfall über ihre Vagina, deren Haare naß und glatt waren, wie ein Pferdeschwanz. Sie schrie, wann es kommen würde. Hassan redete beruhigend auf sie ein, gleich würde es kommen, sagte er. Er hielt ihre beiden Beine weit auseinander. „Pressen mußt du, Gabriela, pressen.“
„Ich kann nicht mehr!“ schrie Gabriela.
Fast ohnmächtig lag sie in Schweiß und Blut. Das Kind war geboren. Hassan schnitt die Nabelschnur durch. Gabriela war erleichtert, als sie das Geschrei des Babys hörte. Hassan lachte sie an: „Einen Knaben hast du bekommen, einen prächtigen Knaben.“
Hassan ließ den Knaben auf ihrem Bauch zappeln, er suchte ihre Brust.
Hans planschte im Wasser, mit Mühe und voller Schrecken schwamm er bis zum Ufer. Klitschnaß stand er da, zitternd vor Angst und Kälte. Als er nach Hause kam, waren alle Lichter erloschen. Gabriela schlief noch. Die Couch war leer wie immer. Hassan war fort. Hans zog sich im Bad aus und duschte ausgiebig, dann ruhte er sich aus, bis es dämmerte. Er holte vier Brötchen und zwei Kaffeestückchen. Frau Thomas war nicht da, er ließ sich von der Aushilfe bedienen. Als er zurückkam, war Gabriela im Bad. Er deckte den Tisch für zwei.
Gabriela setzte sich mit dem Bademantel an den Frühstückstisch. Ein merkwürdiges Gefühl beschlich sie, es drang durch die Haut bis zu den Knochen. Hans ging es genauso. Sie frühstückten ruhig. Nach dem Frühstück blieben sie sitzen. Sie starrten sich gegenseitig in die Augen, als würden sie irgend etwas lesen, als hätten sie neue Besonderheiten ineinander entdeckt. Alles war ungewöhnlich.
Gabriela lachte Hans an, er lachte zurück. Gabriela hob das rechte Bein und legte es auf den Tisch. Der Bademantel stand offen, ihr Busen erschien zur Hälfte, fleischig und fest. Hans bohrte mit seinen Augen überall, wo nur etwas zu erspähen war. Die Haarbüschel zwischen ihren Beinen schimmerten durch, eine Schlucht trennte sie in zwei gleichberechtigte Teile. Hans rutschte auf den leeren Stuhl, auf dem Hassan immer saß, er nahm mit beiden Händen Gabrielas Füße und fuhr, so sanft er nur konnte, über ihre Fußrücken und Zehen. Er bückte sich, nahm den großen Zeh in Mund und erklomm das Bein bis zum Busch der Schamhaare.
Gabriela zog wieder ihre Beine zurück und sagte: „Nicht hier.“
Sie richtete sich auf und warf den Bademantel über den Stuhl. Hans saß angezogen ihr gegenüber. „Trag mich auf die Couch“, forderte Gabriela ihn auf.
Er erschrak. Aber er trug sie. Er war immer noch stark. So feierten sie den ersten Tag im Leben des Knaben auf der Couch. Ein prächtiger Knabe war er!
...
© Glaré Verlag
Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
![]()
 M.
und S. Allafi
M.
und S. Allafi
Der andere Orient 31
Leseprobe:
Auszug aus dem 1. Kapitel:
Iran in der chaotischen (Nicht)-Weltordnung
Heute, drei Jahrzehnte nach dem Zusammenbruch der Ostblock-Staaten, sind die
Konturen neuer ökonomischer, politischer und kultureller Machtzentren
deutlicher zutage getreten. Dabei ist eines zweifelsfrei festzustellen,
nämlich dass der Zusammenbruch des kommunistischen Machtblocks nicht
unbedingt zur Stärkung der sogenannten westlichen Länder (gemeint sind die
USA und Westeuropa) geführt hat, es entstand kein unipolares Machtgebilde
unter Hegemonie der USA, wie von manchen erhofft. Im Gegenteil ist für diese
Länder und spezifisch für die USA ein Prozess der Machterosion zu
beobachten. Die Länder des Westens, insbesondere die USA, befinden sich
mittlerweile in einer Defensivpolitik gegenüber den neuen ökonomischen und
politischen Machtzentren, sie sind nicht mehr tonangebend, sondern einer von
vielen. Wenn auch z.B. die USA und die Europäische Union (EU) auf einigen
Ebenen zweckgebunden kooperieren, so ist dennoch klar zu erkennen, dass die
EU auf keinen Fall im Schatten der amerikanischen Außen- und
Wirtschaftspolitik steht. Selbst hier, diesseits und jenseits des Atlantiks,
findet eine enorme Polarisierung der Interessen statt.
Einige dieser politischen und ökonomischen Machtzentren lassen sich
folgendermaßen bestimmen: die USA, China, Indien, die EU, die G8+5 (USA,
Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada und Russland
sowie China, Brasilien, Indien, Mexiko und Südafrika), die D8-Staaten (Developing
8 Countries: Ägypten, Bangladesch, Indonesien, Iran, Malaysia, Nigeria,
Pakistan und die Türkei), die BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien,
China, Südafrika) oder weitere islamistische Machtzentren, weltweit
agierende mafiöse Machtstrukturen etc. Für die an diesen Machtzentren
beteiligten Staaten stehen innerhalb dieser Strukturen wiederum jeweils ihre
eigenen Interessen im Vordergrund, sodass es trotz äußerlicher Einigkeit
durchaus zu Interessenkonflikten kommt, z.B. innerhalb der EU zwischen
Deutschland, Großbritannien und Frankreich, insgesamt zwischen Süd- und
Nordeuropa (...)
Zu diesen Machtkonstellationen zählen mit Blick auf das Primat der Ökonomie,
welches in den heutigen internationalen Verhältnissen das Primat der Politik
ersetzt hat, auch einzelne Staaten wie Saudi-Arabien, die arabischen
Scheichtümer am Persischen Golf und sogar weitere in der Finanzwelt
dominante Institutionen wie etwa die Drogenkartelle in Nord- und Südamerika
sowie auch Einzelpersonen. Sie sind aufgrund der Finanzialisierung der
Wirtschaft in der Lage ihrerseits maßgeblichen Einfluss auf die Weltpolitik
auszuüben. Zum Beispiel haben Saudi-Arabien mit 5 Milliarden US-Dollar,
Kuwait (mit 4 Milliarden) und die Vereinigten Arabischen Emirate (mit
3 Milliarden) Finanzierungshilfe im Sommer 2013 zum Putsch der ägyptischen
Armee gegen die gewählte islamistische Regierung beigetragen (...) Die
Einmischung arabischer Staaten wie Saudi-Arabien oder Katar geht bis zur
Unterstützung islamistischer Terrorgruppen, etwa in Syrien oder im Irak.
Eine dieser Gruppen, die sogenannte ISIS („Islamischer Staat im Irak und
Syrien“), ist mittlerweile außer Kontrolle geraten und wird als eine
ernsthafte Bedrohung in der Region eingestuft.
Die USA als ehemalige Supermacht sind bei der Schaffung einer neuen
Weltordnung als Wortführer für die Demokratie zum Beispiel im Nahen und
Mittleren Osten kläglich gescheitert, wie die Ereignisse u.a. im Irak, in
Afghanistan, in Syrien und Ägypten bezeugen. Dies trifft auch für das nicht
realisierbare Konzept des sogenannten Erweiterten Nahen Ostens aus der Zeit
der aggressiven Außenpolitik der US-Administration unter George W. Bush zu,
das hauptsächlich darauf ausgerichtet war, den Zugriff amerikanischer
Konzerne auf die Erdölreserven in Kuwait und im Irak sowie im gesamten Nahen
und Mittleren Osten zu sichern und die Basis für eine dauerhafte Anwesenheit
der US-Armee in der Region zu schaffen. Diese Politik führte jedoch im
Gegenteil zur Stärkung der politischen Machtposition Irans in der Region
(insbesondere im Irak, in Syrien und im Libanon) und einer Stärkung der
Wirtschaft der Türkei.
Derzeit zeigt die schwache Außenpolitik der Obama-Administration eine
Beschleunigung des Zerfallsprozesses der USA als Supermacht im Sinne einer
unipolaren (Nicht)-Weltordnung. Mit dem rasanten ökonomischen Aufstieg
Chinas, Indiens, Russlands und Brasiliens und der zunehmenden
Verselbständigung der EU zeichnen sich eindeutig die Konturen einer
multipolaren (Nicht)-Weltordnung ab. In dieser neuen Konstellation versucht
jedes Land oder jedes Zweckbündnis wie die EU mithilfe jeglicher
Machtinstrumentarien vor allem die eigenen ökonomischen Interessen
durchzusetzen. Hierfür gibt es zahlreiche Beispiele, ganz besonders deutlich
wird diese Strategie aber bei den Aktivitäten Frankreichs in Afrika, wo man
aktuell dabei ist, ehemalige Kolonien zu rekolonialisieren, und zwar unter
dem Motto „Demokratie gegen Fundamentalismus“, etwa in Zentralafrika, wo es
um die Sicherung des Zugangs zu Diamanten, Gold und Uran geht. (...)
Deutschland versteckt sich hier hinter der EU und der NATO, um mit Blick auf
Osteuropa und bis weit nach Zentralasien hinein den Machtbereich des alten
Rivalen Russland zu beschneiden, zugleich kokettiert man mit den
finanzstarken archaischen Regimes wie Saudi-Arabien und den Scheichtümern am
Golf. Ein Ergebnis ist das EFTA-Freihandelsabkommen mit den Mitgliedstaaten
des Golf-Kooperationsrates (Bahrain, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien und
die Vereinigten Arabischen Emirate), das am 1. Juli 2014 in Kraft getreten
ist. Bereits 1994 hat die NATO unter dem Motto „Partnerschaft für den
Frieden“ eine Initiative gestartet, um die militärische Zusammenarbeit mit
fast 40 europäischen und asiatischen Staaten zu erleichtern. Zwölf von ihnen
sind zwischenzeitlich der NATO beigetreten.
Zugleich versucht die Europäische Union durch verschiedene Maßnahmen ihre
Absatzmärkte zu erweitern. Währenddessen träumt man in der Türkei vom
Pan-Turanimus oder einem euroasiatischen Machtblock mit Russland, Iran,
China, Indien, Pakistan und den zentralasiatischen Ländern. Manche blicken
auch zurück auf die Grenzen des Osmanischen Reiches und halten ein Bündnis
mit den muslimischen arabischen Ländern für möglich. Diese Träume scheinen
nicht allzu weit hergeholt, wenn man bedenkt, dass immerhin bereits eine
Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft bestehend aus Russland, Weißrussland,
Armenien, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan existiert, aus der 2015
eine Eurasische Union hervorgehen soll.
Im Rahmen der zivilgesellschaftlichen Aktivitäten sind zahllose
islamistische Vereine entstanden, die ihre Leute weltweit gezielt in Macht-
und Kulturzentren einschleusen, damit sie dort bei geeigneter Gelegenheit
ihre Interessen zur Geltung bringen. Ein Beispiel ist die sogenannte
Gülen-Bewegung, die über zahlreiche Vereine und Netzwerke weltweit agiert,
auch in Deutschland mehrere Schulen und Nachhilfevereine betreibt und deren
Mitglieder mittlerweile in der Türkei hohe Posten in der Politik und
Judikative, im Polizeiapparat, in Wirtschaft und Armee innehaben. Hier
nehmen sie Einfluss, ohne als politische Organisation bezeichnet zu werden.
(...)
Solche sogenannten zivilgesellschaftlichen Aktivitäten von Seiten der
iranischen, türkischen und selbstverständlich auch der arabischen Islamisten,
insbesondere aus Saudi-Arabien, wie auch der islamistischen Milliardäre aus
den Scheichtümern, unter dem Vorwand Vereine und Stiftungen zu gründen, sind
weltweit zu beobachten. Während die von Saudi-Arabien unterstützte extrem
konservative Salafisten-Bewegung immer wieder Aufsehen erregt, wirbt die
sogenannte Gülen-Bewegung offiziell für ihr „fortschrittliches“
Islamverständnis. Beide finden weltweit Anhänger. (...)
In dieser multipolaren (Nicht)-Weltordnung scheint also alles erlaubt, von
der Instrumentalisierung der Demokratie durch Oligarchen, die ihre eigenen
„Parteien“ gründen, bis zur Nutzung der Religion und privatester
Angelegenheiten der Menschen wie homosexuelle Liebe – alles dient als
Anlass, um gegeneinander zu Felde zu ziehen. (...)
Iran ist eines der Länder, welche über vielfältige Möglichkeiten verfügen,
in der beschriebenen multipolaren Welt eine positive Rolle zu spielen. Das
Land liegt geopolitisch in einer der wichtigsten Regionen der Welt und hat
sowohl eine Jahrtausende alte kulturelle Affinität zu den zentralasiatischen
Ländern als auch viele Gemeinsamkeiten mit den islamischen arabischen
Ländern. Mit Indien und Pakistan hat Iran mehr historische Berührungspunkte,
etwa sprachliche oder religiöse, als andere Länder, z.B. China oder
Russland, dies haben.
Darüber hinaus hat Iran eine gut ausgebildete Bevölkerung, von der jedoch
ein großer Teil in der ganzen Welt zerstreut ist und von der viele in
Wissenschaft, Handel und Industrie wie auch im Gesundheitswesen auf höchster
Ebene, ob als Unternehmer oder als Angestellte, tätig sind. Das Land stand
und steht trotz der Herrschaft der Islamisten der Moderne nach wie vor sehr
aufgeschlossen, wenn nicht gar begeistert gegenüber, seit hundert Jahren hat
Iran nie den Kontakt zu den wichtigen europäischen Ländern wie Frankreich,
Großbritannien, Deutschland oder Italien abgebrochen. Auch hat Iran aufgrund
der mehr als zwei Millionen dort lebenden Iranerinnen und Iraner, von denen
mehr als 70 % über einen akademischen Abschluss verfügen, eine besonders
enge Beziehung zu den Vereinigten Staaten von Amerika.
Trotz der Vorbehalte des Schah-Regimes gegenüber Russland in der
kommunistischen Ära pflegt Iran sehr enge Kontakte auf wirtschaftlicher und
politischer Ebene mit Russland, die nach dem Zusammenbruch der UdSSR
intensiviert wurden. Iran ist bekanntermaßen reich an natürlichen
Ressourcen, einer der wichtigsten Ölproduzenten der Welt und verfügt nach
Russland über die größten Gasreserven weltweit. Die klimatischen Bedingungen
sind vielfältig, was eine moderne industrielle Landwirtschaft begünstigt.
Aber Iran leidet unter den innenpolitischen Auseinandersetzungen, trotz mehr
als hundert Jahren Streben nach Demokratie und einer freiheitlichen
Gesellschaftsordnung kommt das Land auf dieser Ebene nicht voran.
Insbesondere in den Jahren der Herrschaft der schiitischen Klerikalen hat
Iran immensen innenpolitischen Schaden genommen, ganz zu schweigen von einer
in der Geschichte des Landes beispiellosen außenpolitischen Isolation, und
das, obwohl die iranische Bevölkerung selbst in den Jahren der Islamischen
Republik noch eine für die Region vorbildliche Bereitschaft zur Akzeptanz
der parlamentarischen Demokratie gezeigt und die überwiegende Mehrheit der
politischen Klasse trotz enormer Repression, trotz Gewalt und Folter, aus
der Geschichte gelernt hat und für einen sanften und friedlichen Übergang
von dem destruktiven theokratischen Regime zu einer auf Vernunft und Respekt
basierenden demokratischen Gesellschaft und eine friedliche Koexistenz mit
dem Ausland bzw. der Welt steht, auch wenn, wie wir zeigen werden, die
islamistischen schiitischen Politiker, die mit Gewalt das Ruder in der Hand
halten, verschiedene Gelegenheiten für einen solchen sanften Übergang
zunichte gemacht haben.
Die sogenannte Islamische Republik Iran ist heute – das lässt sich mit
Sicherheit sagen – auf politischer, kultureller und moralischer Ebene im
Hinblick auf die selbst beanspruchte islamische Religion praktisch am Ende.
Der Staat im Sinne einer Einheit verschiedener islamistischer Gruppierungen,
„höherer“ Geistlicher (politisch aktiver schiitischer Mullahs),
Funktionsträger und Funktionäre ist heute durch und durch zerrüttet. Die
zweimalige Durchsetzung Mahmud Ahmadinedschads als Präsident durch das
Militär (die Revolutionsgardisten) und Schlägertruppen (bestehend aus
staatlichen Almosenempfängern aus ländlichen Gebieten, marginalisierten
Gruppen sowie Kriminellen vom Rande der Megastadt Teheran) mit wohl
kalkulierter Unterstützung der fanatischen Geistlichen und dessen Scheitern
haben deutlich zutage treten lassen, dass der Zerfall des Regimes durch
nichts mehr aufzuhalten ist. Das Regime stellt sich mittlerweile quasi
selbst in Frage und bekämpft sich selbst auf allen Ebenen. Und die
islamistischen Akteure sind nicht in der Lage, den Teufelskreis der
Theokratie zu durchbrechen und sich daraus zu befreien. (...)
© Glaré Verlag
Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
![]()
Der andere Orient 30
114 Seiten.
14,90 Euro
ISBN 978-3-930761-85-2
Leseprobe:
Auszug aus der Titelerzählung:
Der Tag neigte sich dem Ende zu. Die Sonne war zwar noch nicht untergegangen, groß und deutlich war sie am Horizont zu sehen, aber bereits in dem orangefarbenen Ton, der für das menschliche Auge angenehmer ist und mehr Ruhe als Hitze ausstrahlt. Der alte Mann kehrte von seinem Spaziergang zurück. Er ließ sich etwas erschöpft auf der Bank vor seinem Häuschen nieder, um die letzten Minuten der täglichen Reise der Sonne zu beobachten. Mittlerweile hatte sich dies zu einem Ritual entwickelt. Überhaupt hatte er seinen Tagesablauf ritualisiert. Viele kleine Handlungen, die sich tagtäglich wiederholten und die ihm zum einen Sicherheit gaben und zum anderen kleine Tagesetappen darstellten, auf die er sich freuen konnte. Besonders galt diese Freude dem friedlichen Sonnenuntergang, den er von seiner Bank aus, die genauso wie sein Haus in einem höheren Abschnitt des Dorfes gelegen war, gut bestaunen konnte. Es war ein Augenblick größter Seelenruhe. Dass er hin und wieder, wenn die Sonne hinter den Bergen verschwand und der Himmel langsam dunkler wurde, daran denken musste, dass das Licht seines Lebens auch immer schwächer wurde, trübte diesen Moment nicht. Er war ein zufriedener Mann, hatte nie große Erwartungen im Leben gehabt und wurde somit auch selten enttäuscht. Er war älter geworden als er sich das jemals erhofft hatte und war bereit die letzte Reise seines Lebens anzutreten oder anders gesagt seiner Seele die nächste Reise zu gewähren. Er fürchtete sich nicht vor dem, was danach kommen sollte. Würde er eine Brücke überqueren müssen, um ins Jenseits zu gelangen? Würde er mit einem Boot über einen Fluss gefahren werden? Oder aber würde er in ein schwarzes Loch fallen, in einen unendlichen Schlaf ohne ein Sein danach?
Ein kleiner Junge kam den Schotterweg hochgelaufen. Er war gut gelaunt, hopste nach jedem Schritt in die Höhe und schien etwas zu singen. Mit der rechten Hand hielt er etwas fest, das um seinen Hals hing. Eine Kette wahrscheinlich. Der alte Mann kannte den Jungen, es war der Sohn des Metzgers. Er pflegte stets den alten Mann zu grüßen, so auch dieses Mal. „Seien Sie gegrüßt, Haj Agha!“
Zwar hatte er die große Pilgerreise nach Mekka nie angetreten, aufgrund seines hohen Alters jedoch wurde er von allen im Dorf mit diesem Titel angesprochen. „Wie geht es Ihnen? Sind Sie bei bester Gesundheit? Schauen Sie nur, was ich hier habe!“ Der Junge öffnete seine rechte Hand, in der sich ein Teil der Kette zeigte, aber zur Überraschung des alten Mannes offenbarte sich in der kleinen Hand auch ein Plastikschlüssel.
„Ah, das ist ja ein Schlüssel, mein Junge. Hast du einen Schatz gefunden? Ist das der Schlüssel zu deiner Schatztruhe?“ Der alte Mann lächelte ihn an.
„Nein, das ist der Schlüssel zum Paradies.“
Das Lächeln des Mannes wurde zu einem lauten Lachen. „Na, mein Junge, den Schlüssel zum Paradies, den würde ich auch gerne haben. Kannst du ihn mir besorgen? Wo bekomme ich ihn? Weißt du überhaupt, was das Paradies ist?“
„Na klar weiß ich das. Ob Sie auch einen Schlüssel bekommen können, da bin ich mir nicht sicher. Ich kann aber natürlich morgen fragen. Ich habe ihn heute in der Schule bekommen. Wir haben einen Mann aus der Stadt zu Besuch gehabt, der uns etwas über den Schlüssel und das Paradies erzählt hat. Er war sehr nett. Ich glaube aber – um ehrlich zu sein – diese Schlüssel sind nur für Kinder, Haj Agha. Der Mann aus der Stadt hat unsere Lehrer nicht angesprochen und auch nicht erwähnt, dass unsere Eltern einen haben können. Wahrscheinlich gibt es für Erwachsene andere Schlüssel. Aber, Haj Agha, erzählen Sie nicht, dass ich den Schlüssel habe. Eigentlich bekommt man den erst kurz vor dem Einzug in die Schlacht.“
Der alte Mann war sichtlich amüsiert über die Ausführungen des Kleinen. „Welche Schlacht meinst du denn? Der Schlüssel ist wahrscheinlich eine Belohnung für deinen Fleiß in der Schule, stimmt’s?“ Dabei streichelte er ihm über den Kopf.
„Nein, also ja, eine Belohnung, aber das hat nichts mit der Schule zu tun. Das ist nicht mehr wichtig. Wir sind doch im Krieg gegen den Feind aller Gläubigen, gegen den bösen Yazid. So hat es der Mann aus der Stadt gesagt, und die tapferen Kinder aus meiner Klasse werden mitkämpfen, damit wir diesen Krieg gewinnen. Wir werden als Märtyrer sterben und mit diesem Schlüssel direkt ins Paradies einziehen. Wir werden keine Sorgen mehr haben und immer reichlich zu essen. Wir werden in einem grünen Garten leben und müssen nicht mehr arbeiten, das hat er uns versprochen. Keine Hausaufgaben, keine Hausarbeiten, keine Ohrfeigen, ach, es wird so schön sein! Und wir werden den verborgenen Imam sehen, der ist nämlich auch im Paradies, und vielleicht auch noch den Propheten, das weiß ich nicht mehr. Haj Agha, ich muss aber jetzt gehen, es wird dunkel, meine Mutter wartet auf mich. Ich werde mich aber verabschieden, bevor ich ins Paradies gehe.“
Der alte Mann war sprachlos. Sein vor wenigen Augenblicken noch fröhliches Gesicht war wie versteinert. Er wollte dem Jungen etwas nachrufen, konnte sich aber nicht einmal konzentrieren um „Tschüss“ zu sagen. Konnte das wahr sein, was er gerade gehört hatte? Hatte der Junge vielleicht nicht richtig zugehört in der Schule? Würden die jetzt wirklich Kinder in den Krieg schicken?
...
© Glaré Verlag
Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
![]()
 M.H.
Allafi
M.H.
Allafi
Gabriela findet einen Stapel Papier
Roman in 15 Kapiteln und 8 Stapeln
East meets West 11
340 Seiten. 15,90 Euro
ISBN 978-3-930761-79-1
Leseprobe:
VII. Stapel
... Du suchst Vergebung und vergibst den anderen. Du vergibst den anderen und sie vergeben dir. Du wirst staunen, wenn ich dir sage, dass hier nicht nur kein Mensch einen anderen Menschen tötet, sondern dass auch die Tiere vor ihnen verschont bleiben. Es bleibt dir nur noch übrig, mit dir selbst reinen Tisch zu machen, und das tust du quasi automatisch. Selbst die grausamsten Despoten, Mörder und Henker der Welt stehen hier freiwillig zu ihren Taten und nehmen freiwillig die Konsequenzen für ihre Bosheiten auf sich. Und es gibt tatsächlich eine lodernde Hölle! Es gibt auch lieblich plätschernde Bäche, die eine unbeschreiblich idyllische Natur durchziehen, so wie im Garten Eden vielleicht, und vieles mehr. Niemand bestimmt über dich, ob dich die Hölle erwartet oder das sogenannte paradiesische Departement, du bestimmst über dich selbst, entsprechend deiner Taten oder Missetaten auf Erden, und zwar wirklich fair, und niemand kommt auf die Idee, dir diese Entscheidung abzunehmen.

Ich hatte hier einen merkwürdigen Gasgeruch wahrgenommen. Als ich die Ursache suchte, habe ich etwas entdeckt, Gabriela, das du dir nicht vorstellen kannst! Da ist Adolf Hitler, der Tag und Nacht auf glühenden Kohlen hin und her marschiert, und wenn er erschöpft ist, geht er zur Erholung in die Gaskabine, dreht den Hahn auf und duscht ausgiebig, bis er abermals stirbt, und danach wacht er wieder auf. Er hat sich vorgenommen, dies für jeden durch ihn ermordeten Menschen eine Million Tage und Nächte lang zu tun. Nun rechne mal hoch, wie lange er noch damit beschäftigt ist! Und das ist noch nicht alles, was er sich vorgenommen hat, denn er will sich danach für jede Kugel, die ein deutscher Soldat geschossen und die einen Menschen das Leben gekostet hat, eine Million Mal erschießen lassen. Er will sich auch für jeden Gefangenen, der im Gefängnis oder im Konzentrationslager eingesperrt war, eine Milliarde Tage und Nächte einsperren. Und er will sich für jeden Menschen, der unter seiner Herrschaft gefoltert wurde, millionenfach foltern. Außerdem will er sich für jedes beleidigende Wort, das er in seinem Leben dort verloren hat, millionenfach beschimpfen, und er will für jedes jüdische Baby, das die deutschen Nazis an die Wände klatschten und sich dabei amüsierten, seinen Kopf, so lange er existiert, wenn er an einer Wand vorbeigeht, gegen die Wand klatschen und dabei fürchterlich weinen.
Ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt: Ich bin einer vom deutschen Volke. Da verneigte er sich vor mir. Das kannst du dir nicht vorstellen, der große Führer, vor dem sich ein Volk verbeugte, stand nun gebeugt vor mir. Er bat um Entschuldigung für das, was er den Deutschen angetan hat. Und er sagte weinerlich: „Mein Sohn, ich schäme mich, ein Deutscher zu sein. Ich weiß, hier ist niemand der Sohn oder die Tochter eines anderen, aber ich will einfach jemanden aus meinem Volk bzw. aus den Scharen der Menschen, die sich das deutsche Volk genannt haben, ehrlich und aufrichtig meinen Sohn nennen. Das deutsche Volk, das waren einfache Menschen, die sich von einem wie mir verführen ließen. Ich habe gehört, sie sind immer noch einfach gestrickt und gehen dem einen oder anderen sehr schnell auf den Leim. Sie sind also immer noch in Gefahr, von einem Verrückten wie mir in die Irre geführt zu werden.“ Und damit schoss er sich vor meinen Augen, peng, peng, ein paarmal in den Kopf. Du weißt, wie abgrundtief ich diesen Adolf gehasst habe, und nun war es so, dass ich ihm alles vergab, aber er vergab sich selbst nicht. Ich sagte zu ihm: „Führer, leider gibt es immer noch Leute, die sich nach deiner Zeit zurücksehnen und dir huldigen.“ Als er das hörte, weinte er bitterlich und schlug sich mit beiden Händen abermals ins Gesicht und schoss sich abermals in den Kopf. Ich habe gesagt: „Führer, es gibt Leute, die heute sagen, die Juden und Muslime haben andere Gene als die Deutschen, minderwertige Gene, und sie schreiben Bücher, die millionenfach unter den Deutschen verkauft werden.“
Da schluchzte er jämmerlich und erschoss sich abermals und sagte: „Hör bitte auf, diese Schwachköpfe wissen nicht, was ihnen bevorsteht! Nenn mich bitte auch nicht Führer, du kannst mich Dieb, Verbrecher, Mörder, Halunke, was auch immer, nennen, aber bitte nicht Führer! Ich weiß, dass die Menschen hier ein menschliches Benehmen haben, und ich würde mich nicht so nennen, das ist das Grausamste daran, wenn sie wüssten, wie weit ich mich von meinen menschlichen Eigenschaften im hiesigen Sinne entfernt hatte. Ich, Adolf, habe damals aus politischen Gründen dem sogenannten deutschen Volke gehuldigt, und sie waren so leichtgläubig, haben allen Mist, den ich ihnen erzählte, geglaubt, sie wussten nicht, dass ich sie hasste. Wenn ich die Deutschen geliebt hätte, wie ich behauptete, dann hätte ich ihr Stückchen Land nicht in Schutt und Asche legen dürfen. Ich weiß, viele haben freiwillig mitgemacht, mich sogar angestiftet, so weiterzumachen, aber ich bin hier nur für mein eigenes Tun verantwortlich, und ich weiß, was ich gedacht und getan habe, und nur dafür bin ich verantwortlich und gehe freiwillig in die Hölle, die meiner Meinung nach relativ zu dem, was ich getan habe, ein Paradies ist, und das meine ich ernst.“
Ehrlich gesagt, er tat mir leid, und so habe ich darauf verzichtet, ihm weiter von den Menschen zu erzählen, die direkt und indirekt wie Adolf denken und handeln.
Hier sieht man, liebe Gabriela, wie ungeheuerlich die Menschen von ihrem Wesen des Mensch-Seins dort abgewichen sind. Du würdest wahrscheinlich, wie ich dich kenne, fragen, wie ein menschlicher Mensch eigentlich sein soll? Das ist eine gute Frage, aber die Antwort darauf ist einfach, jedenfalls aus der Sicht des Menschen selbst, denn sie könnte lauten: Der Mensch soll einfach unschuldig sein, also keine Schuldgefühle haben, und dieses Gefühl steht immer in Beziehung zu den anderen Lebewesen, seien es Menschen, seien es Tiere und Pflanzen, sei es die Materie selbst. Aber das ist die Angelegenheit der Menschen dort, lass mich nun weiter von hier erzählen.
...
I. Stapel
Ich heiße Hans bzw. man nannte oder rief mich Hans. Ich bin geboren in einem Kaff am Rande Asiens, in einer Gegend, die man Europa nannte, genauer gesagt in der Mitte eines namentlich geografisch festgelegten Fleckchens Erde, nämlich in Deutschland. Hier bin ich zur Schule gegangen, habe studiert, habe mich mit den Menschen und ihren Problemen auseinandergesetzt und habe eine Menge bittere und süße Erfahrungen einstecken müssen. Ich habe bis zu meinem Tod nicht aufgehört, mir über die Menschen und die sogenannte Gesellschaft Gedanken zu machen, und ich habe bis zum Ende geglaubt und war fest davon überzeugt, dass die Menschen wirklich ein besseres Leben verdient hätten und dass sie tatsächlich besser sein könnten als sie waren und sind. Ich habe am Ende auch das Gefühl gehabt, dass ich nichts erreicht habe, nicht aus dem Grund, weil ich mit leeren Händen aus dem Leben schied, das war vorherzusehen, es war eben wie mein Eindringen ins sogenannte Leben. Nein, ich habe das Gefühl gehabt, nichts zurückzulassen, also meinen Nachkommen nichts zu vererben. Wie meine Nachkommen das sehen, kann ich nicht einschätzen, wahrscheinlich wird es genauso sein wie ich meine eigenen Vorfahren eingeschätzt habe, die auch nichts davon wussten.
Ich heiße Hassan bzw. man nannte oder rief mich Hassan. Ich bin geboren in einem Kaff in Zentralasien am Fuße des Zagrosgebirges, dieses Stückchen Erde in Zentralasien hieß geografisch gesehen Iran. Von dort aus bin ich durch Teile der Welt gezogen und schließlich auf einem kleinen Fleckchen Erde gelandet, das man Deutsche Lande nannte, zumindest zu meinen Lebzeiten. Ich bin zur Schule gegangen und habe studiert, habe mich mit den Menschen und den sogenannten Gesellschaften und deren Problemen auseinandergesetzt. Ich glaubte bis zum Tod, die Menschen hätten ein besseres Leben verdient und besser sein können als sie waren und sind. Ich habe am Ende das Gefühl gehabt, dass ich nichts erreicht habe, nicht aus jenem Grunde, dass ich mit nichts an mir aus dem Leben schied, das wusste ich. Nein, eher war es so, dass ich, was ich gedacht und getan habe, niemandem vermitteln konnte, mit anderen Worten, ich habe für meine Nachkommen nichts zurückgelassen. So jedenfalls habe ich mich, bevor ich von der Bahn des Lebens entgleiste, gefühlt. Wie meine Nachkommen das sehen, kann ich nicht beurteilen, genauso wie meine Vorfahren es nicht beurteilen konnten, wie sehr ich sie geschätzt habe.
Wir, Hans und Hassan, sind weder verrückt noch gemein noch irgendwelche Arschlöcher. Was wir, Hans und Hassan, sagen, ist nicht die letzte Wahrheit, aber es ist eine Wahrheit. Was wir sagen, bezieht sich auf das, was wir gesehen, erlebt und gedacht haben.
...
Hassan hat mir erzählt, was er einmal erlebt hat, nämlich als er mit einem Freund ins Gespräch vertieft am Rande eines Gehwegs entlanglief und ihn ein deutscher Greis, der ziemlich groß und kräftig war, mit der rechten Schulter angerempelt hat, so heftig, dass er beinahe hingefallen wäre. Erschrocken rief er dem Mann nach, ob er wohl nicht richtig sehe, aber der reagierte nicht und stapfte stocksteif weiter. Da regte Hassan sich auf.
Sein Freund aber sagte: „Lass doch, das sind alte Nazis, die extra Ausländer anrempeln.“
Hassan schrie dem Greis nach: „Heh, du alter Nazi!“
Da blieb der mit einem Mal stehen und drehte sich um. Sein Freund versuchte Hassan zu beschwichtigen: „Verdammt noch mal, du darfst in Deutschland nicht einfach jemanden als Nazi beschimpfen, das ist doch verboten!“ Er fürchtete, der Alte werde sich jetzt auf das Gesetz berufen und ihm drohen, ihn anzuzeigen, dass es eine Unterstellung sei und es keinen gerichtlichen Beweis für das gebe, was er ihm da unterstelle. Nun würde ein ungeplanter Ärger seinen Lauf nehmen. Man würde sich entschuldigen müssen, eventuell sogar bestraft werden, weil man zu einem Nazi Nazi gesagt hatte… Da riss der deutsche Greis den Mund auf und, stocksteif wie er war, brüllte er: „Ja, das bin ich! Und ich bin stolz darauf!“ Dann drehte er sich zackig wieder um und lief weiter. „Oh, mit so was habe ich nicht gerechnet. Der ist nicht nur ein Nazi, sondern auch ein mutiger Nazi. Das glaubt dir kein Mensch, wenn du es jemandem erzählst“, sagte Hassans Freund damals zu ihm.
...
Hans hat mir erzählt, was er einmal erlebt hat, als ein angesehener liberaler deutscher Philosoph vor linken Studenten sprechen wollte und sie die Veranstaltung gestört haben. Da nannte der Philosoph diese Leute Links-Faschisten und zog damit die Empörung der Links-Radikalen auf sich. Ein berühmter Soziologe hat in Amerika feststellen können, dass die Leute, die sich Demokraten nennen, mitunter gar keine Demokraten sind, und die Leute, die sich Faschisten nennen, keine Faschisten. So ist zu erklären, dass nicht maßgeblich ist, wie die Leute sich etikettieren, sondern wie die Leute innerlich sind. Die innere Einstellung führt zur Entstehung der Ideologien und Weltanschauungen, und darauf basieren Massenhysterien. Viele dieser ehemaligen Links-Radikalen sind im Laufe der Jahre konservativ geworden, manche sogar offizielle Rechts-Extremisten, und umgekehrt gab und gibt auch es jede Menge Beispiele. Hans war empört darüber, dass es in den Reihen der Sozial-Demokraten jede Menge Rechte und Rechts Extremisten gibt, die sich nach außen als Demokraten und sozial verkauften und in späterer Zeit zeigten, dass sie weder sozial noch Demokraten waren. Manche von ihnen gingen zu den Neo-Faschisten, andere schrieben rassistische Bücher gegen Araber, gegen Muslime, und fielen richtiggehend in den Rassismus und Sozial-Darwinismus zurück…
Ich weiß, habe ich Hans gesagt.
Aber Hans ließ nicht locker, er erzählte mir fast die gesamte Geschichte der deutschen Elite, der Mehrheit der Deutschen und das Leiden der aufrichtigen Intellektuellen und anderer Persönlichkeiten. Zum Beispiel wurde damals Heinrich Heine verjagt, Thomas Mann ausgebürgert, Karl Marx verteufelt, in der Nazi-Zeit musste die gesamte deutsche Intelligenzia auswandern… Er erzählte und erzählte, beinahe wären mir die Augen zugefallen....
Wir, Hans und Hassan, hatten irgendwann die Nase voll, uns wäre es lieber gewesen, mit blinden Augen und tauben Ohren durch die Welt, durch unsere kleine Welt, genauer gesagt, unser Leben, zu ziehen und so stumpf weiterleben zu können, aber es ging nicht, denn um zu überleben bzw. um weiterzuleben, muss man tausend Augen und Ohren haben, dort genau hinschauen, hier aufmerksam hinhören, so manchen anblicken, dem anderen so zuhören, wie er gehört werden möchte. Es war verdammt schwer.
...
1. Kapitel
Doch, es war etwas geschehen. Gabriela wusste noch, dass sie am Vorabend nicht allein gewesen war. Nun hatte sie ein merkwürdiges Gefühl, das sie sich nicht erklären konnte. Während des Frühstücks versuchte sie, sich an die letzte Nacht zu erinnern. Aber es war unmöglich, denn diese Nacht war sehr lang, länger als ein Leben. Gabriela sah keinen Sinn darin, sich mit dieser Nacht zu beschäftigen. Es war ungeheuerlich, sein ganzes Leben noch einmal Revue passieren zu lassen. Sie war völlig konfus und hatte das Gefühl, dass lauter wirre Gedanken nicht nur durch ihren Kopf schossen, sondern ihr ganzes Nervenkostüm in Aufruhr versetzten, ohne dass sie sich gegen diesen Wirrwarr in irgendeiner Weise zur Wehr setzen konnte.
Ohne den Frühstückstisch abzuräumen, fing sie an, durch die Wohnung zu streifen, um den Sturm der Erinnerungen zu lindern. Aber sie waren einfach da, selbst in jeder Ecke ihrer Wohnung waren Erinnerungen angehäuft. In dem leeren Zimmer stand die Tür des alten Kleiderschranks offen, seit Jahren hatte niemand diese Tür geschlossen. In dem Schrank hingen nur die alte Hose ohne Tasche und ein Hemd mit einem Kugelschreiber in der Brusttasche, auf dem Schrankboden stand ein Paar alter Schuhe. Sie kannte diese Utensilien. Im Grunde genommen war dieser Schrank ein Schrank der großen Erinnerungen. Sie hatte es nie über sich gebracht, den Schrank oder die alten Klamotten zu entsorgen, immerhin gelang es ihr, die Dinge zeitweise zu ignorieren. Aber heute waren ihr die Sachen im Schrank wieder wichtig, sie erschienen ihr wichtiger als je zuvor.
Die Schranktür quietschte und fiel ins Schloss. Gabriela erschrak nicht, aber sie lief aus dem Zimmer. Genau in diesem Moment klingelte es an der Wohnungstür. Sie eilte in den Flur, sie wusste, dass jemand direkt vor der Tür stand, da der Klingelton an der Wohnungstür sich von dem an der Haustür unterschied. Sie dachte, es wäre ein Nachbar. Aber es war niemand da. Gabriela trat aus der Wohnung, um sich im Treppenhaus umzuschauen. Es war tatsächlich niemand da. Sie hatte schon den Verdacht, sich alles nur eingebildet zu haben, da entdeckte sie einen Karton. Er baumelte direkt über ihrem Kopf. Jemand hatte ihn an der Decke angebracht, mit einem Seil dort aufgehängt. Das war unheimlich, und noch unheimlicher war, dass an dem Karton ein weißes Blatt hing, auf dem in großen schwarzen Lettern geschrieben stand: FÜR GABRIELA. Dieser Zettel war so angeklebt, dass man die Schrift ohne Mühe und ohne Brille lesen konnte.
Gabriela rannte wieder in die Wohnung, holte einen Stuhl und eine Schere. Sie stieg auf den Stuhl und schnitt die Schnur durch. Dann stieg sie wieder herunter und stellte den Karton auf den Stuhl. Beinahe hätte sie ihn schon im Treppenhaus geöffnet, doch sie hob ihn mit dem Stuhl hoch und schleppte beides in die Wohnung. Kaum hatte sie die Tür hinter sich geschlossen, riss sie den Karton auf und fand darin einen Stapel Papier, einen dicken Stapel Papier. Auf der ersten Seite war geschrieben: „Von Hans und Hassan für Gabriela. Erzähl es möglichst vielen, du kannst es natürlich auch gleich verbrennen oder zum Altpapier werfen, aber es ist die Wahrheit.“
Beinahe hätte sie gesagt: „Ach die beiden, die hatte ich schon vergessen.“
Sie sagte aber nichts, denn sie hatte sie keineswegs vergessen, zumindest Hans war ihr allgegenwärtig. Sie war noch mehr entschlossen zu akzeptieren, dass sie am Vorabend nicht allein gewesen war, Hans war da, und dieser im Treppenhaus über ihrem Kopf baumelnde Karton hatte auch damit zu tun. „Nein, nein!“, murmelte sie vor sich hin. „Ich war allein! Na ja, eigentlich nicht ganz allein, aber es waren doch bloß Erinnerungen!“
Warum hatte sie sich am Vorabend so intensiv an Hans erinnert und warum war da heute dieser Karton über ihrem Kopf? Dafür gab es keine Erklärung. „Es gibt vieles, das ich mir nicht erklären kann“, flüsterte sie.
...
© Glaré Verlag
Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
![]()

180 Seiten.
14,90 Euro
ISBN 978-3-930761-81-4
Prolog
Sie lag im Bett und dachte an den Tod, der durch ihre Adern floss. Dachte daran, dass in sechs Monaten vielleicht alles vorbei war. Dachte an eine junge Ägypterin, die ihr Baby stillte. Eine Erfahrung, die sie selbst nie machen durfte. Spürte in sich die Sehnsucht nach den Berührungen, die sie allzu lange vermisst hatte. Dunkle Haut auf heller. Ihr Körper hatte nie akzeptiert, dass sie ihren Stolz den Sieg über ihr Herz hatte davontragen lassen. Ihr Körper schrie nach den Händen, dem Mund und dem wunderschönen Glied ihres ägyptischen Prinzen. Warum hatte sie sich nicht mit dem zufrieden geben können, was möglich war? Warum hatte sie alles haben wollen?
Alles oder nichts.
Jetzt hatte sie nichts. War sie nun glücklicher?
Als der Tag sein erstes Licht in Streifen durch den Rollladen in ihr Zimmer schickte, fasste sie einen Entschluss. Morgen würde sie einen Flug buchen. Dorthin, wo sie das größte Glück und das größte Leid erfahren hatte.
...
© Glaré Verlag
Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
![]()
 M.H.
Allafi
M.H.
Allafi
Die letzte Nacht mit Gabriela
East meets West 5
304 Seiten. 21,50 Euro
ISBN 978-3-930761-19-7
Leseprobe:
1
Schulter an Schulter, Hand in Hand, völlig geistesabwesend, gingen sie, vorwärts oder rückwärts, das machte keinen Unterschied, aber sie gingen. Wohin sie gingen und warum, war nicht zu erkennen. Dort zu bleiben, wo sie waren, vermochten sie auf keinen Fall. Gab es irgendwo ein „wo“, das anders war? Wenn ja, wo war dann dieses „wo“?
Niemand ahnte es, niemand wagte es zu ahnen! Niemand hatte Zeit, und die Zeiten waren schlecht. In schlechten Zeiten denkt der Mensch entweder viel nach, wenn auch nicht unbedingt tief schürfend, oder er denkt gar nicht. Wozu denken? Wozu nachdenken? Nein, Nachdenken führt zu Stillstand, man muss eben gehen, bis es vergeht. Und beim Gehen darf der Mensch nicht zurückschauen, sonst bemerkt er, was er hinter sich angerichtet hat, gerät womöglich in Angst und Panik, dazu kommt höchstwahrscheinlich ein schlechtes Gewissen. So wächst die Gefahr des Stillstands. Behaupten deswegen die Politiker oder ins Unglück gestürzte Menschen, zum Beispiel nach einem Brüderkrieg, in dem viele unschuldige Schwestern und Kinder beiderlei Geschlechts umgekommen sind: „Man muss immer nach vorne schauen.“?
Vorne, was ist das eigentlich? Das ist doch grotesk – der Mensch hat eine Geschichte, und ohne diese Geschichte ist er kein vollständiges Wesen. Also hat der Mensch ein Hinten und ein Vorne, er hat Seiten und Winkel und auch ein Innen und ein Außen. Der Mensch ist gut und böse, wie viele Große sagten, und wie der Mensch eben ist.
Hans wandte sich zu Gabriela: „Hast du was gesagt, meine Liebe?“
„Nein!“, hauchte sie.
„Ach so, dann kam es mir nur so vor!“
2
Gabriela schlug die Zeitung auf und schaute nach den Todesanzeigen. Unter einem großen Kruzifix stand geschrieben: „Ich trauere um meine liebe Tochter Mechthild. Sigrid Thomas.“
Sie zündete sich eine Zigarette an und nahm einen kräftigen Zug. Auf die Anzeige niederstarrend, versank sie in Gedanken. Mechthilds Tod war schon traurig genug, genauso wie ihr Leben. Aber diese Anzeige schien Gabriela noch trauriger. Niemals zuvor hatte eine Todesanzeige sie so ergriffen. Es war nicht bloß eine Todesanzeige, es war die Anzeige der Einsamkeit einer Frau. Eine Frau tat vielen tausenden Menschen ihre tiefe Trauer kund. Je länger Gabriela nachdachte, desto ratloser wurde sie, warum Frau Thomas so etwas inserierte. Mechthild war vor zehn Wochen beigesetzt worden, Gabriela und Hans waren auf der Beerdigung gewesen, und nicht nur sie, es waren viele, mindestens fünfzehn Leute ohne den Gottesmann, der Mechthild mühelos als vorbildliche Christin bezeichnete, obwohl er wusste, dass ihr verstorbener Mann ein Moslem gewesen war. „Am Ende sind alle Menschen gleich, Gottesgeschöpfe“, hatte er gepredigt.
Frau Thomas war ermattet gewesen, es schien aber, als habe sie sich im Griff. Sie stand am Grab mit gesenktem Kopf und erstarrter Miene, ohne eine einzige Träne zu vergießen, ohne den geringsten Mucks. Ihre Augen glänzten, aber sie waren trocken wie eine Wüste, in die man endlos weit hineinschauen konnte. Mit diesen Augen hatte sie gesehen, wie Mechthild sich nackt auf die Schienen warf. Aber sie hatte nicht mehr gesehen, was mit ihrem Körper geschah. Sie war umgekippt, und man nannte es einen großen Glücksfall, dass sie unversehrt geblieben war, nur ihr rechter Ellenbogen war etwas aufgeschürft. Nun war ihr der kleine Körper ihrer lieben Tochter auf dem Wickeltisch allgegenwärtig, wie sie strampelte und wohlige Laute von sich gab. Zugleich hallte immer noch ihre eigene Stimme in ihrem Kopf wider: „Warte, warte!“
Mechthild hatte nicht gewartet, sie war davongeprescht wie ein Reh, wie ein unschuldiges Reh, ein Stadtreh.
Frau Thomas war immer noch der Auffassung, wenn Mechthild nicht diesen iranischen Arzt geheiratet hätte, sie nicht mit ihm nach Iran gezogen und er nicht hingerichtet worden wäre, und wenn ihr Sohn sich nicht viele Jahre später erhängt hätte, dann wäre Mechthild ein anderes Schicksal beschieden gewesen, vielleicht ein besseres, vielleicht ein schlimmeres, aber Hauptsache ein anderes. Sie wünschte sich von ganzem Herzen, ihre Tochter wäre ein Baby geblieben. Frau Thomas hatte Mechthild sehr geliebt, über alles. Kein Wunder, dass sie sich wie eine Wüste fühlte, ihre Augen waren ausgetrocknet, wie nach einer langen Dürre.
…
Gern wäre sie Schauspielerin geworden, am liebsten eine berühmte Schauspielerin, wenn sie ihren Mann, den Bäckermeister Joachim Thomas, nicht kennen gelernt hätte. Rosinen hatte sie damals im Kopf, trotz der Beschwerlichkeiten der Nachkriegszeit, trotz oder vielleicht gerade wegen Elend und Trauer in ihrem verwüsteten Vaterland. Ihr schauderte, wenn sie an die damalige Zeit zurückdachte. Die Heirat mit Joachim Thomas hatte sie an diese Backstube gebunden, insbesondere nachdem sie Mechthild geboren hatte. „Eine schöne Tochter habe ich auf diese unschöne Welt gebracht“, hatte sie immer wieder zu ihrem Mann gesagt. Mit Mechthilds Geburt waren tatsächlich alle Wünsche, die Frau Thomas je gehabt hatte, entflogen, sie waren abgestorben, wie sie selbst betonte. Später akzeptierte sie alles als einen Wandel in ihrem Leben, in dessen Zentrum das Baby Mechthild stand, daneben die Backstube und ihr Mann und natürlich die Hausarbeit.
Richtiges Glück hatte sie in ihrem Leben nie gehabt, genauso wenig wie ihre Tochter. Ihr Mann war bei einem Autounfall ums Leben gekommen, mit dem ersten Auto, das sie sich hatten leisten können, mit diesem Auto hatte Frau Thomas fahren gelernt. Seit dem tödlichen Unfall ihres Mannes fuhr sie kein Auto mehr. Sie war und blieb konsequent, wie es eben ihre Art war. Sie gab Mechthild auch kein Geld für den Führerschein. Mechthild bestand auch nicht darauf. Sie hatte erst, als sie den Doktor kennen gelernt und sich richtig mit ihm angefreundet hatte, fahren gelernt. Der Doktor war überrascht gewesen, dass eine moderne junge Frau in Deutschland nicht Auto fahren konnte. Als sie ihm erzählt hatte, weshalb ihre Mutter dagegen war, hatte der Doktor gesagt: „Ich dachte, bei euch gäbe es keinen solchen Aberglauben.“
„Leider gibt es den immer noch“, hatte Mechthild geantwortet. Es war erstaunlich, wie der Doktor und Mechthild sich von Tag zu Tag besser verstanden, wie sie miteinander harmonierten und sich gegenseitig ergänzten. Frau Thomas hing sehr an Mechthild und die wies ihre Mutter nicht zurück, solange ihr Mann am Leben war und sie mit ihm ein glückliches Leben führte. Als Mechthild nach dem Selbstmord ihres Sohnes – ihr einziger und das für sie lebenswichtige Andenken an das schöne vergangene Leben mit ihrem Mann, ja zugleich der Grund für ihr Weiterleben – verrückt geworden war, hatte Frau Thomas alles versucht, um sie bestmöglich zu pflegen. Nun war mit Mechthilds Tod für sie alles erledigt. Sie lebte quasi in einer toten Vergangenheit, sie quälte sich durch ihr verbliebenes Leben, mit der Erinnerung an die tote Vergangenheit, die für sie keineswegs tot war. Sie konnte nichts dafür, es ging ihr einfach so. Je älter sie wurde, desto lebendiger wurde die Vergangenheit für sie, desto nachdrücklicher kam sie immer wieder in ihr hoch. Das war der Grund für die Aufgabe der Anzeige, und sie hatte vor, dies in regelmäßigem Abstand immer wieder zu inserieren. Nicht nur das, Frau Thomas suchte immer nach einem Anlass, sich wieder in ihre tiefe Trauer zu stürzen. Wenn sie die Nachricht von einem Mord hörte oder davon, dass dieser oder jener tödlich verunglückt war, und wenn die weinenden Angehörigen kurz auf dem Fernsehschirm auftauchten, dann weinte sie unweigerlich mit. Es kam von selbst, das Gefühl, zu trauern und der Wunsch, sich auszuweinen. Insbesondere der tödliche Unfall von Prinzessin Diana aus dem englischen Königshaus machte ihr zu schaffen. Bevor sie unter Tränen der Beisetzungszeremonie auf dem Fernsehschirm folgte, war sie jeden Tag in der Frankfurter Fußgängerzone, auf der Zeil, gewesen, wo per Videokassette Auszüge aus dem Leben der Prinzessin über einen im Auftrag der Ladenbesitzer aufgestellten Bildschirm flimmerten. Sie hatte sich neben die fremden Leute, die auf dem nackten Boden kauerten, auf eine Bank gesetzt und mit ihnen getrauert. Jeder trauerte für sich. „Der Tod einer so warmherzigen Lady ist der beste Anlass für eine Nation, die wirklich trauerbedürftig ist“, hatte ein frecher Journalist kommentiert.
Frau Thomas schrieb jeden Tag etwas in das Kondolenzbuch, das dort ausgelegt war. Einmal formulierte sie: „O liebe unschuldige Prinzessin, ich habe auch eine Prinzessin verloren, eine unbekannte Prinzessin.“ Manches Mal tropften ihre Tränen auf die Seiten des aufgeschlagenen Buches und ließen die Tinte verlaufen. Ganz besonders berührte es sie zu sehen, wie die Prinzessin diese armen kleinen Kinder anderer Leute an ihre majestätische Brust drückte. Dann kullerten ihr dicke Tränen aus beiden Augen. Sie konnte nichts dafür, es kam einfach von selbst.
Gabriela zündete sich ihre zweite Zigarette an, immer noch vertieft in die Anzeige, als ob sie sie wirklich studierte. Sie bestellte eine weitere Tasse Milchkaffee. Im Café TELP war um diese frühe Stunde wenig los. Sie war hier um elf Uhr mit Hans verabredet. Nun war es halb zwölf und Hans ließ sich immer noch nicht blicken. Das letzte Mal war sie Hans ausgerechnet auf dem Friedhof zu Mechthilds Beerdigung begegnet. Er war für seine Zeitung dort gewesen, er wollte eine Story über das tragische Schicksal der Selbstmörderin schreiben, wohl eher aus persönlichem Interesse. Doch seine Hoffnung, von Frau Thomas mehr über Mechthild zu erfahren, wurde enttäuscht. Frau Thomas war außerstande, auch nur zwei zusammenhängende Sätze hervorzubringen, geschweige denn Hintergrund und Motive eines Selbstmordes, auch noch von einer Verrückten. Überdies hatte sie nicht mehr zu erzählen, als dass die Heirat ihrer Tochter mit dem iranischen Arzt und ihre Reise nach Iran für all das Unglück ihres Lebens verantwortlich seien. Das hatte sie schon hundert Mal gesagt und Hans wusste es auch. Dort, während der Beisetzung von Mechthild vor zehn Wochen, hatten Gabriela und Hans sich für heute verabredet, früher ging es nicht.
Beinahe wären es dieses Jahr zwei Jahrzehnte, wenn Gabriela und Hans sich nicht getrennt hätten, dass sie ihren Frühstückstisch mit Brötchen aus Frau Thomas‘ Backstube deckten. Zwei Jahrzehnte, in denen Hans dafür sorgte. Ihre Trennung nahm im Grunde genommen an jenem Tag ihren Anfang, an dem Gabriela erfuhr, dass Mechthild durchgedreht war. Sie und ihre Mutter hatten bis zu diesem Zeitpunkt nicht die geringste Rolle im Leben von Hans und Gabriela gespielt. Hans wusste nicht einmal, dass Frau Thomas überhaupt eine Tochter hatte, er hatte ihr stets einen guten Morgen gewünscht und sie ihm ebenfalls, wenn er bei ihr Brötchen kaufte. Zufälligerweise waren Gabriela und Mechthild Klassenkameradinnen gewesen, eine Freundschaft hatte es zwischen den beiden nie gegeben. Gabriela hielt sich für schlau und Mechthild für naiv. Gabrielas Freunde hatten diese Einstellung Mechthild gegenüber geteilt. Nach der Schule trennten sich ihre Wege völlig. Nein, nein, sie konnte wirklich nicht ahnen, dass Mechthild und ihre Mutter eines Tages ein Thema für sie würden. Sie waren auch kein Thema für sie geworden. Es war nur ein Datum, an dem Hans und Gabriela gewahr wurden, dass sie seit langer Zeit als Ehepaar nichts mehr miteinander verband als zusammen zu frühstücken, was sie allerdings in letzter Zeit auch nicht mehr taten. Ihr gemeinsames Leben war im Grunde genommen seit vielen Jahren völlig verbraucht. Dennoch kam ein Funken Hoffnung von außen und dies hielt sie für kurze Dauer zusammen. Doch nach dieser Zeit empfanden sie keinen Funken und keinen Reiz mehr, weder von außen noch von innen her. So waren sie mit einem Male nicht mehr imstande, einander etwas Schönes oder Anregendes zu bieten. Es existierte zwischen beiden nichts mehr, absolut nichts. Und so wurde der Scheidungsprozess eingeleitet.
Endlich tauchte Hans auf, aber nicht allein, sondern in Begleitung einer relativ jungen Frau, mit langem dunklem Haar und sehr hübsch. Hans und Gabriela küssten sich nicht zur Begrüßung, seit langem küssten sie einander nicht mehr, nicht einmal pro forma. Nein, nein, sie wollten nicht wie so viele ihrer ehemaligen Freunde kalte und künstliche Küsschen austauschen.
„Es tut mir Leid, dass es so spät geworden ist“, sagte Hans. „Es gibt heute jede Menge zu tun, bei der Zeitung. Die Außen- und Finanzminister der großen Industrienationen treffen sich im Arabella Grand Hotel. Da ist die Hölle los.“
„Der sehr großen“, fügte die Frau lachend hinzu und mit den Händen malte sie dabei einen dicken Bauch in die Luft. Es schien, als sei sie ulkig oder doch kritisch.
Hans arbeitete für die außenpolitische Redaktion einer Zeitung beziehungsweise mehrerer Zeitungen. Nun saßen alle drei an dem Tischchen. Hans stellte die Frau vor: „Victoria, eine Kollegin, die für englischsprachige Zeitungen schreibt.“
Dann wandte er sich zu Victoria: „Du kennst Gabriela, ich habe dir von ihr erzählt.“
Gabriela fühlte sich durch diesen Überfall völlig überrumpelt. Bemüht, ihre Fassung wiederzugewinnen, zündete sie sich erst einmal eine Zigarette an und bot Victoria ebenfalls eine an. Die lehnte ab: „Danke, ich rauche nicht.“
„Ich dachte, Journalisten und Zigaretten seien untrennbar“, gab Gabriela zurück. Sie wusste nicht, warum sie den Drang verspürte, Victoria anzugreifen, aber sie fügte hinzu: „Sie haben doch meist eine Zigarette im Mundwinkel stecken, wenn sie die großen Ereignisse dieser Welt konzentriert in ihre tragbaren Computer tippen. Auf jeden Fall posieren sie meist so.“
„Nicht immer und nicht alle“, entgegnete Victoria lächelnd. „Es gibt sicher viele verblödete und arrogante Affen in dieser Zunft. Aber ein paar Gute gibt es auch immer.“
Hans nahm eine Zigarette, allerdings von seinen eigenen. Er rauchte seit einiger Zeit, seit er nicht mehr in der Lokalredaktion arbeitete, wieder Gauloise. Ob er dadurch seine Wichtigkeit zu unterstreichen suchte oder ob es sich um eine Art zweiter Frühling handelte, wer sollte das sagen? Vor vielen Jahren hatten sie beide Gauloise geraucht, in jenen guten alten Zeiten.
Es herrschte ein kurzes Schweigen. Victoria wirkte locker und strahlte irgendwie Vertrauen und Herzlichkeit aus. Das ermutigte Gabriela: „Ich dachte, wir wollten heute über unsere verbliebene Beziehung reden.“
„Das dachte ich auch, Gabriela. Aber wie gesagt, heute ist so viel los. Frag Victoria.“
Victoria lächelte. Die Kellnerin stellte vor Victoria ein Kännchen Tee und vor Hans eine Tasse Kaffee hin. Hans nippte sofort an seiner Tasse. „Eine Tasse Kaffee ist im Hotel schweineteuer“, kommentierte er. Dann wandte er sich zu Gabriela: „Wir sind nur gekommen, um dich kurz zu treffen, ich wollte eigentlich erst anrufen und sagen, was los ist. Aber dort hieß es, die Minister würden auch eine Pause machen, und bis zum Ende der Sitzung ist strengste Zurückhaltung vereinbart. So hatten wir nichts zu berichten. Da sind wir hierher gekommen. Ich habe mir überlegt, es wäre besser, wenn wir uns einen Abend bei mir oder bei dir treffen würden und uns besprechen, obwohl ich meine, dass es nicht viel zu besprechen gibt. Victoria kann dabei sein.“
Die Scheidungsurkunde hatten sie schon längst in der Tasche. Das Gespräch sollte eher für Herz und Seele sein als für eine praktische Orientierung.
„Ich bin sehr interessiert.“ Victoria lächelte. „Hans hat viel von eurem Leben erzählt, ich finde es spannend, wie ihr gelebt habt oder lebt. Wenn ihr nichts dagegen habt, können wir uns auch bei mir treffen.“
Hans hatte nichts dagegen, er war sogar dafür. Gabriela schien ratlos, sie wusste nicht, wie sie antworten sollte. Sie trank ihren restlichen Kaffee und zündete sich wieder eine Zigarette an. Dabei sagte sie, es sehe alles wie eine billige Fernsehserie aus.
Nun wurde Victoria persönlicher und erklärte: „Nein, so ist es nicht. Rauch nicht so viel, Gabriela. Es war nur eine spontane Reaktion von mir. Ich weiß viel über dich, deshalb interessiere ich mich für dich.“
Dass Victoria sie gleich geduzt hatte und so aufgeschlossen war, verwunderte Gabriela. Diese Art von Offenheit und Spontaneität rief in ihr die Erinnerung an etwas Vertrautes wach, von dem sie in diesem Moment nicht sagen konnte, was es war.
Gabriela hatte keine Einwände gegen die Anwesenheit von Victoria, sie zog es aber vor, das Treffen bei sich stattfinden zu lassen. Warum sie sich mit einem Mal so engagierte und Gastgeberin sein wollte, wusste sie selbst nicht recht. Vielleicht einfach aus Neugierde oder weil sie nichts anderes zu tun hatte. Sie hatte allerdings stets äußerst viel zu tun beziehungsweise sorgte sie dafür. Seit sie getrennt lebten, war ihr Terminkalender voll, rannte sie von Veranstaltung zu Veranstaltung, von einer Freundin zur anderen. Sie hatte sogar mehrere Frauentreffen organisiert, ein spätfeministischer Versuch. „Warum nicht, warum eigentlich nicht?“, sagte sie sich, wenn sie vor dem Spiegel stand. Sie stand immer noch gern vor dem Spiegel. Sie konnte sich immer noch minutenlang ausgiebig betrachten und sie fand, dass sie sich immer noch gut gehalten hatte, ja dass sie schön war, sehr schön sogar. Zuerst hatte sie beschlossen, einen netten Mann kennen zu lernen: „Er muss ja nicht unbedingt emanzipiert sein“, hatte sie sich vor dem Spiegel gesagt. „Bei Gott, er muss nicht Geschirr spülen oder kochen, nein, ein Mann, der in der Lage ist, mich als Frau zu sehen, reicht mir vollkommen.“ So sprach sie vor dem Spiegel oder manchmal, wenn sie Glück hatte, auch im Traum ihre Wünsche aus. Zumindest redete sie sich ein, es wären ihre Wünsche. Als sie jedoch feststellen musste, dass es keinen solchen Mann gab und die Auswahl auch alles andere als reichlich war, schloss sie sich der Gemeinschaft der Singles an. Mit einigen von ihnen hatte sie sogar Vorgespräche über die Gründung einer Wohn- oder einer Hausgemeinschaft für später einmal, wenn sie alt wären, geführt. Alle waren grundsätzlich mit dieser Idee einverstanden. Sie mussten sich nur noch auf einen Ort einigen. Die meisten bevorzugten Nordspanien. „Warum nicht?“, hatten sie gesagt. „Billig und warm ist es dort jedenfalls.“
Gabriela, Hans und Victoria zückten ihre Terminkalender und einigten sich auf den Samstag in sechs Wochen um neunzehn Uhr bei Gabriela, anders ging es nicht, denn vorher waren alle ausgebucht. Sie würde für alles sorgen, auch für den Rotwein für Hans. „Wenn die Minister sich auch so schnell einigen würden, hätten wir vielleicht heute schon miteinander reden können“, meinte Gabriela ironisch.
Hans und Victoria mussten wieder zur Ministerrunde. Sie gingen und ließen Gabriela allein zurück, ganz allein, aber nicht ganz so allein wie Frau Thomas. Sie hatte immer noch und trotz allem viele Pläne und frische Gedanken für die Zukunft. Das plötzliche Auftauchen von Hans in Begleitung von Victoria irritierte sie nicht im Geringsten. Nicht bloß aus dem Grund, dass zwischen ihr und Hans keinerlei intime Beziehung mehr bestand, auch nicht, weil sie überhaupt in keinerlei Hinsicht Eifersucht gegeneinander hegten, das hatten sie in den vielen Jahren ihres Zusammenlebens, insbesondere wenn es um Liebesbeziehungen ging, immer wieder bewiesen, sondern weil Gabriela fest davon überzeugt war, dass Hans nie wieder mit einem Menschen eine vertrauliche Beziehung aufbauen konnte oder wollte. Damit hatte sie sogar Recht, Hans war seit Jahren am Ende des so genannten normalen Lebens angelangt, wie Gabriela auch. Seine Annäherung zu Victoria musste einen anderen Grund haben. Welchen, das war ihr gleichgültig.
Sie nahm die Zeitung, die auf dem Stuhl neben ihr lag, wieder in die Hand, schlug sie auf und studierte noch einmal die Anzeige. Dann winkte sie die Kellnerin herbei, sie wollte bezahlen. Während sie zahlte, fragte sie die Kellnerin, ob sie die Anzeige ausreißen dürfe. Sie würde die Zeitung auch bezahlen.
Die Kellnerin antwortete lächelnd: „Du kannst dir doch selbst eine kaufen. Wenn wir eine neue Zeitung kaufen, müssen wir sie noch mal in den Zeitungshalter klemmen.“
In Café TELP duzten die Bediensteten und Gäste einander. Das schien in der Tradition der guten alten Zeit immer noch die Regel zu sein, um eine freundschaftliche oder lockere Atmosphäre zu schaffen. Die Verbitterten, die sich von dieser guten alten Zeit verabschiedet hatten, nannten diese Atmosphäre scheißfreundlich oder pseudo-locker. Wie dem auch sei, Gabriela fand es hier gut und auch die Leute, die hier arbeiteten und sich trafen.
„Ach so, ich dachte, wegen dieser einen Anzeige würdet ihr keine neue Zeitung kaufen.“
„Doch, doch“, sagte die Kellnerin. Und während sie auf die Anzeige schaute, fuhr sie fort: „Viele lesen gerade die Anzeigen, besonders diese Anzeigen hier.“
„Warum?“, fragte Gabriela. „Weißt du das?“
„Ich nehme an, es sind die einzigen ehrlichen Worte, die man heutzutage in den Medien findet“, antwortete die Kellnerin grob. „Was man liest und hört, sind entweder die eigenen Lügen der Zeitungsleute oder die Lügen der Politiker oder was weiß ich, was die Zeitungsleute uns erzählen.“
Gabriela lächelte verkrampft, sie hatte keine Lust, mit ihr zu diskutieren und ihr verständlich zu machen, dass sie ein bisschen differenzierter urteilen solle. Seit langem hatte sie sich vorgenommen, nicht mehr in die Rolle der Besserwisserin zu schlüpfen. „Ist gut so“, sagte sie distanziert, als die Kellnerin ihr das Restgeld aushändigen wollte. Diese war wohl zufrieden, mit so viel Trinkgeld hatte sie vermutlich nicht gerechnet, und wünschte Gabriela noch einen guten Tag.
Gabriela schlenderte durch die Straßen, um vielleicht einen guten Tag zu erleben. Bislang war der Tag nicht so gut verlaufen, oder erwartete sie zu viel von den Menschen? Am ersten Kiosk kaufte sie eine Zeitung. Sie schlug sie direkt vor dem Kiosk auf und riss die Anzeige heraus. Nun wollte sie die restliche Zeitung dem Kioskbesitzer schenken. Der lächelte sie an: „Legen Sie sie auf den Stapel neben dem Eingang.“
Tatsächlich lag dort neben dem Eingang des Hauses, in dessen Erdgeschoss sich auch der Kiosk befand, ein Berg Zeitungen. Gabriela schlug verwundert, erst gelassen, dann hastig, mehrere davon auf. Bei allen fehlte die Anzeige, immer dieselbe Anzeige. Sie steckte ihre Anzeige gut sichtbar in ihren Geldbeutel und ging weiter. Ihr ging durch den Kopf: ,Sollte man doch nur über diese Anzeige zwei wahre Worte miteinander austauschen? Hat die Kellnerin Recht? Ist alles andere gemogelt und geschummelt?‘ Mit einem Mal wusste sie es selbst nicht mehr.
Für heute hatte sie das Gespräch mit Hans eingeplant, aber sie sorgte immer für einen Reserveplan, für den Fall, dass es wie heute mit einem Termin nicht klappte. Nun hatte sie noch einen Ersatztermin. In die Bibliothek wollte sie gehen und sie ging hin, und zwar zu Fuß. Sie hatte genug Zeit, aber sie mochte keine Zeit haben, jedenfalls keine freie Zeit. „O Gott, alle meine Freunde haben keine Zeit. Sie haben immer etwas Wichtiges zu tun“, sagte sie sich oft vor dem Spiegel.
Der Mann saß immer noch im Pausenraum, der eher als Raucherraum diente, und schnippelte Anzeigen aus Zeitschriften und Zeitungen aus. Er tat das seit Jahren, es war seine Arbeit, wenn man es überhaupt so nennen durfte, eine Beschäftigung war es schon. Niemand wusste warum und wofür. Viele meinten, er wäre verrückt, er sei der Sohn einer reichen Familie, sein Vater sei ein Industrieller, sonst könnte er sich diese sinnlose Tätigkeit überhaupt nicht leisten. Die Bibliotheksbediensteten tolerierten ihn und er verstand sich gut sowohl mit dem Pförtner als auch mit dem Personal des Cafés und natürlich auch mit den Frauen und Männern von der Bücherausgabe. Selbst manche Beamten und Beamtinnen des höheren Dienstes, die ab und zu steif wie der Zeigefinger des Staates vorüberstiefelten, hatten nichts gegen ihn und seine Anwesenheit einzuwenden. Er störte niemanden, nicht einmal die Besucher, und vor allem sprach er sehr wenig. Ab und zu schnitt er eine Seite aus einer Zeitung oder einem Magazin und legte sie auf den Tisch vor einen Besucher, den er kannte, hin, und der lächelte ihn an. Gabriela kannte ihn seit Jahren. Sie war gespannt, ob er heute diese Anzeige ausschneiden und sie vor ihr auf den Tisch legen würde. Aber sie irrte sich, er bearbeitete nie aktuelle Zeitungen und Magazine, sondern nur ganz alte. Woher er die besorgte, war auch nicht ganz klar. Man vermutete nur, er würde sie vor allem in Arztpraxen oder Anwaltskanzleien und Ähnlichem sammeln, die für seine kostenlose Arbeit sogar dankbar wären.
Heute tat er so, als sei er Gabriela überhaupt noch nie in seinem Leben begegnet, geschweige denn dass er sie kannte, denn Gabriela war seit langem nicht mehr in der Bibliothek aufgetaucht. Sie war übrigens deutlich älter geworden, vielleicht war das der Grund. Aber er, er war jung geblieben, wie damals vor vielen Jahren. Für ihn waren Zeit, Raum und die Menschen und alles um ihn herum anscheinend unbedeutend. „Wie kann jemand nur so sein?“, diese Frage stellten sich viele, die ihn sahen. Besonders ausländische Studenten, die ihn genauer als ihre deutschen Kommilitonen sozusagen in Augenschein nahmen, empfanden sein Tun als eine Merkwürdigkeit, und einige machten sich seinetwegen sogar ernsthafte Gedanken und versuchten, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Er war ihnen gegenüber zwar etwas offener, dennoch antwortete er stets nur mit einem Lachen auf ihre Fragen.
Gabriela wunderte sich auch über ihn, und zwar sehr. Mit einem Mal interessierte sie sich für ihn, genauer gesagt für das, was er tat. Sinn hatte seine Beschäftigung wirklich nicht, schon gar nicht für andere, die ihn von außen betrachteten. Oder hatte es doch einen Sinn, nämlich den, die Sinnlosigkeit des Lebens, die alle anderen verschwiegen, aufzudecken, oder dachte er wie die Kellnerin, die Anzeigen seien die einzigen ehrlichen Worte der Menschen, obgleich er auch viele kommerzielle Anzeigen ausschnitt? Gabriela setzte sich und unternahm den Versuch, ihn in ein Gespräch zu verwickeln. „Arbeitest du fleißig?“, hauchte sie in den Raum.
Er hob leicht den Kopf, sagte nichts und schnitt weiter mit seiner Schere die Anzeigen aus. „Warum tust du das?“, war der zweite Satz von ihr.
Er schaute sie noch einmal an und schwieg. Seine Blicke durchbohrten sie, als würde er sagen: „Die blöde Gans, was für eine Frage sie stellt ...“
Seit Jahrzehnten hatte ihn niemand danach gefragt, warum er das tat, was er so eifrig tat. Wie er die Menschen ignorierte, so ignorierten sie ihn. Gabriela lachte ihn noch einmal an, aber vergeblich. Er legte seine Schere auf den Tisch neben den Stapel Magazine und Zeitschriften und nahm einen Becher Fruchtbuttermilch, der neben ihm auf dem Boden stand. Während er kurz daran nippte, musterte er sie verstohlen. Dann stellte er den Becher wieder zur Seite, nahm die Schere in die Hand und fuhr mit seiner Arbeit fort. Kein einziges Wort brachte er hervor, er wollte es nicht. Es ging niemanden etwas an, was er tat und warum er es tat. Er wollte in Ruhe gelassen werden. In Ruhe seine Anzeigen ausschneiden. Vielleicht war er ein Anzeigensammler, wie andere Briefmarkensammler sind. Vielleicht sortierte er die Anzeigen alphabetisch in einem Album oder nach Firmen- und Personennamen. Warum tat er diese Schnipselei nicht bei sich zu Hause? Hatte er überhaupt ein Zuhause? Er hatte eines, schließlich kam er jeden Tag gepflegt und ausgeruht zur Bibliothek. Nie stapelte er wie der Mann, der Bücher über Ufos auslieh, die Bände vor sich und um sich herum auf dem Tisch und schlief dann hinter dieser Mauer ein, wobei er sogar manchmal schnarchte. Zwar hatte er im Lesesaal einen Tisch für sich reserviert, auf den er sein Arbeitsmaterial legte – einen Tisch so sinnlos zu besetzen, war auch kein Problem, denn es gab genügend freie Tische und Stühle für die Lesenden und Forschenden – aber seine Ausschnitte fertigte er nur im Pausenraum, nicht einmal im Café. Ab und zu latschte er hinüber in den Lesesaal und holte einige Zeitschriften von seinem Tisch, leise und rücksichtsvoll und immer mit einem süffisanten Lächeln auf den Lippen, als halte er das emsige Studieren dieser Massen für das größte Absurdum des Universums.
Gabriela war erstaunlich gelassen und gab nicht auf. Sie deutete auf eines der Magazine und fragte, ob sie hineinschauen dürfe. Sie wusste von damals, dass er sich freute, wenn ihn jemand danach fragte. Er antwortete nicht, nahm aber das von ihr gewünschte Magazin und legte es vor sie auf die schwarze Platte des kurzbeinigen quadratischen Tischs. Gabriela saß nur mit einem halben Meter Abstand von ihm an diesem Tisch. Der Raum war mit zwei solcher Tische und einigen niedrigen Sesseln und Couchs, zwei Aschenbechern und einem Papierkorb möbliert. Es war eigentlich kein abgeschlossener Raum, sondern bloß eine Nische, die durch einen schmiedeeisernen Raumteiler, die Stäbe kunstvoll mit schwarzen Platten kombiniert, vom großen Foyer der Bibliothek abgetrennt war. In dieser verdammten Ecke hatte Gabriela viele Stunden ihres Lebens verbracht. Es war die schönste Zeit ihres Lebens gewesen, wenn sie jetzt nachsann. Nun saß sie nach so vielen Jahren wieder hier und beobachtete den Mann, der unermüdlich Anzeigen ausschnitt, und versuchte vergeblich, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Es störte sie kaum, dass sie wieder hier war, oder es störte sie doch und sie verdrängte das einfach. Beides war möglich. Beides war ihr gleichgültig. Sie erlebte sie noch einmal oder erinnerte sich jeden Tag aufs Neue an die Dinge und Episoden ihres Lebens, die sie quälten und die sie eben abermals verdrängen musste.
Nun verzichtete sie darauf, in dem Magazin herumzublättern, stattdessen zog sie die Anzeige von Frau Thomas aus ihrem Portemonnaie und legte sie auf den Tisch. Der Mann hielt für einen Augenblick inne und warf einen flüchtigen Blick auf die Anzeige, dann schüttelte er den Kopf. Nein, sie interessierte ihn nicht.
Gabriela steckte das Stück Papier wieder ein. Mit einem Mal hatte sie keine Lust, länger dort zu bleiben. Sie erhob sich. Als sie den Raum verließ, sagte sie: „Tschüs.“
Der Mann antwortete nicht, er hob nicht mal den Kopf. Gabriela war nun alles gleichgültig. Ein Kurzschluss in ihrem Gehirn brachte sie zu dem Punkt, an dem sie keinerlei Sinn darin sah, wieder in die ferne Vergangenheit zurückzusinken. Sie suchte einen Ausweg aus der Ausweglosigkeit ihres Alltagslebens, genauer gesagt dieses Tages ihres Lebens. Die Vergangenheit war keine gute Adresse.
Sie verließ die Bibliothek. Kaum war sie auf der Straße, freute sie sich auf den kommenden Abend, an dem sie mit ein paar Freundinnen zum monatlichen Tanz in einer Diskothek verabredet war.
…
© Glaré Verlag
Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
![]()
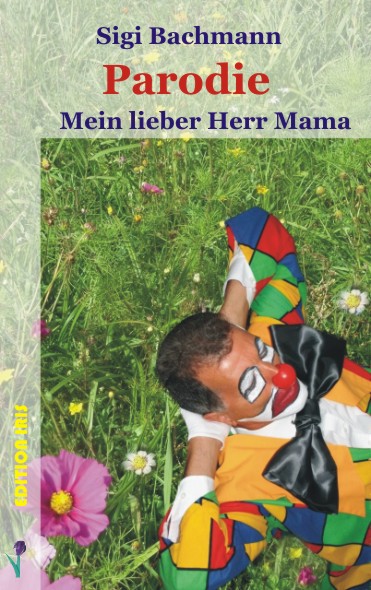 Sigi
Bachmann
Sigi
Bachmann
Parodie -
Mein lieber
Herr Mama
Edition Iris
130 Seiten. 12,90 Euro
ISBN 978-3-398562-02-4
Leseprobe:
Dieses Gesicht, das ich vor mir im Spiegel sehe, dieses Gesicht eines sentimentalen, alten Narren, der seine Zeit damit verbringt, sich in der Vergangenheit zu vergraben.
Letzte Weihnachten besuchte mich meine Tochter und ich fragte sie, ob sie auch Kinder wolle. Sie hat meine Frage weder mit „Ja“ noch mit „Nein“ beantwortet. Dennoch hörte ich etwas ganz Besonderes, etwas Außergewöhnliches von ihr, denn sie sagte: „Nur wenn ich einen Mann kennen lerne, der eine gute Mutter ist, so wie du, mein lieber Herr Mama. Weißt du, ich habe dich immer bewundert. Für mich bist und bleibst du mein allerbester Freund.“
Was wollte ich mehr vom Leben als diesen ganz besonderen Satz von meiner Emma zu hören! Dieses Gelingen war nicht nur mein Verdienst, es war ebenso auch der meiner Tochter, die meine Botschaft verstand.
Ich sehe wieder in den Spiegel und sehe Augen, deren Blick vor Einsamkeit oft fast verging. Wie häufig ertappte ich mich dabei, beim Zurückfallen in meine inneren Monologe.
Soll ich mich fragen, ob wirklich alles so gewesen ist, so wie ich es in meiner Erinnerung trage? Besonders viele Fotografien existieren nicht von Emma, nur ein paar von ihren Geburtstagen, von Weihnachten, von irgendwelchen Ausflügen oder Festen. Aber mein Kopf platzt bald vor Bildern, Szenen und Eindrücken, die eine prägende Faszination für mich heraufbeschwören. Meine gegenwärtigen Erinnerungen sind unwiederbringliche Vergangenheit, aber noch so lebendig, als sei alles erst vor ein paar Minuten geschehen. Sie suchen sich einen manifesten Platz, zwischen vorbei und gerade jetzt.
Wieso bleiben unsere Kinder in unseren Erinnerungen lieber klein? Das ist eine so sinnlose Frage, aber sie löst eine Flut schmerzlicher Gedanken in mir aus.
Habe ich in meiner Einfalt genau das Richtige getan, auch wenn man es eigentlich nur falsch machen kann? Jetzt, im Nachhinein, muss ich sagen, ich war mir damals überhaupt nicht bewusst, was es heißt, ein guter Vater zu sein, und was es ausmacht, einer zu werden. Ich weiß nur, es gibt keine perfekten Väter – aber perfekte Mütter gibt es auch nicht. Oder blieb ich ein erbärmlicher Narr, der sich in seinem gekränkten Stolz selbst beweisen wollte?
Manchmal höre ich den für mich merkwürdig klingenden Satz, und mittlerweile hasse ich diesen Spruch, wenn Frauen so stolz und naiv verkünden: „Ich habe meinem Mann ein Kind geschenkt.“ – Denn für mich wurde dieser blöde Spruch zur Wirklichkeit.
Meine Exfrau hat mir im wahrsten Sinne des Wortes ein Kind geschenkt. Und dann hat sie mich verlassen. So etwas gibt es. Ich bin ein Single mit Kind, Vater mit Tochter.
Sie war – einfach so – gegangen. Dazu erklärte sie lediglich, das einzige, was sie wisse, sei, dass sie ihr Leben alleine besser in den Griff bekäme. Eine Feststellung, die sie in einem sehr frühen Stadium ihres Lebens wahr machte.
Väter tun so etwas, aber Mütter doch nicht! So mal kurz um die Ecke gehen, Zigaretten holen, und dann verschwinden. Vielleicht schaffte ich es damals, meine Enttäuschung in jenem Moment vor ihr zu verbergen. Doch ich spürte tief, wie verraten und verkauft ich mich fühlte, es war strafende Verachtung und hilfloser Zorn, was in mir aufstieg.
Heute sage ich: Das Beste daran war, ich bin gerne „Vater“. Wieso auch nicht? Millionen Frauen haben das gleiche Schicksal, das ist doch schon beinahe normal. Wieso sollte ich es nicht schaffen? Ich stand zu meinem „Vaterdasein“, und zu meiner Tochter.
- - -
Eines Morgens um 2.17 Uhr im Kreißsaal ertönte ihr kräftiger, schriller Schrei. Unsere Tochter war geboren. Mit schwellender Brust begann ein neuer Schritt des Lebens, das heißt eigentlich Schnitt, denn eigenhändig durfte ich die Nabelschnur durchtrennen. Frisch gebadet und gewickelt wurde das kleine Wesen seinem Erzeuger in die Arme gedrückt. Keine Worte können diesem Glücksgefühl auch nur annähernd einen realen Ausdruck verleihen.
Es gibt keinen Moment im Leben, der die Menschheit einander ähnlicher macht als das Erlebnis einer Geburt, dieser Moment, wenn man sein Kind das erste Mal im Arm hält: diese chaotische Mischung aus Wunder der Natur, eigenem Fleisch und Blut, zukünftiger Herausforderung und hilflosem Neubeginn.
Sie war so ein süßes Baby, mein Baby, für immer und ewig. Sagen das nicht immer die Mütter?
Für mich stellte jener Moment alle bisherigen Anschauungen, moralischen Verpflichtungen und Rollenverteilungen auf den Kopf. Meine entmündigte Zukunft bestand von nun an aus Emma und mir, also uns. Wir lernten alles Althergebrachte zu vergessen, jegliche Logik, alles Konventionelle und Normale. Wir entpolarisierten die Regeln und gaben alldem einen neuen Wert und Nutzen, neue Bedeutungen. Wir waren notgedrungen offen für alle neuen Ideen und Ideale. Kann ich nicht, gab es nicht! Mein Ziel war es, nichts Unmögliches von uns zu verlangen. Jedoch gab ich jeder Möglichkeit eine andere Dimension.
Männer arbeiten stets an Aufgaben, Zielen und Projekten, das ist männlich, das ist wichtig. Meines hieß Emma, war 52 Zentimeter groß, wog 3130 Gramm und hatte kein einziges Haar auf dem Kopf.
Ich hatte immer Kinder gewollt, meine Frau niemals. Eigentlich war es mein Problem und auch mein Fehler, dass ich sie dazu überredet hatte. Was heißt überredet, es war einfach passiert. Fairerweise muss ich Karin hoch anrechnen, dass sie, als wir erfuhren, dass sie schwanger war, zu ihren anderen Umständen stehen konnte. Sie konnte sich zwar nicht darüber freuen, im Gegensatz zu mir. Sie erwähnte allerdings auch niemals das Thema Abtreibung oder Freigabe zur Adoption. Karin zog ihre Schwangerschaft mit allen Konsequenzen durch. Sie rauchte nicht, sie trank nicht und nahm auch keine Medikamente. Sie verhielt sich absolut pflichtbewusst. Nur das Kind wollte sie nicht. Ich wollte es einfach nicht wahr haben. Naiv meinte ich, das würde sich geben, wenn das Kind erst einmal da sei. Aber für sie war da nichts zum sich ergeben. Sie bekam für mich mein Kind. Mehr konnte ich nicht von ihr verlangen. Anscheinend war dieser Preis für sie schon zu hoch.
Die Geburt verlief ohne Komplikationen, trotzdem hatte ich mir ein solches Ereignis nicht so bewegend vorgestellt, wie es war. Irgendwie hatte ich ein furchtbar schlechtes Gewissen, als Karin so da lag, in ihren heftigen Wehen. Aber sie war stoisch tapfer. Augen zu und durch, das war ihr Ziel.
Doch von Anfang an konnte sie sich nicht überwinden, Emma in die Arme zu nehmen, sie war nicht in der Lage, sie zu streicheln, geschweige denn küssen. Sie konnte Emma nicht annehmen, nicht ihretwegen und nicht meinetwegen. Sie wollte und konnte auch nicht mit mir oder sonst jemandem darüber reden. Karin hüllte sich in Schweigen. Damals glaubte ich noch, das hätte etwas mit der Wochenbettdepression zu tun, schließlich hatte ich mich ja vorher schlau gemacht. Aber so war es nicht, ich täuschte mich gewaltig. Als ich meine beiden Frauen voller Stolz vier Tage später nach Hause holte, packte Karin ihre Koffer und ging.
Damals hatte ich überhaupt nicht die Zeit, über meine Wut nachzudenken, doch sie war präsent und wurde zu meinem langjährigen treuen Begleiter. Ich weiß auch nicht, wann Karins Entscheidung fiel, wann ihr innerer Durchbruch kam. Zwar hatte sie neun lange Monate genügend Zeit gehabt, doch für mich kam ihr Entschluss überraschend. Ich kam mir betrogen vor, weil ich keine Chance hatte, meine Grenzen mit einzubringen. Karin bestimmte meine bzw. unsere Zukunft, ohne sich selbst einzubeziehen. Sie deswegen zu hassen, hätte ich wahrlich Grund genug gehabt, aber ich konnte es nicht. Es hätte nur abgefärbt, und Emma hatte schließlich nicht meinen Hass, sondern meine Liebe verdient.
Ich hatte weder Mut, Courage, noch die erforderliche Portion Idealismus, mein Hauptbestandteil war eine erbärmliche, aufgestaute Wut. Es war ein beängstigendes Gefühl, so im Stich gelassen zu werden. Meine Zukunft wurde in Bahnen gelenkt, in denen ich meine Orientierung verlor, alles war mit einem Mal fremdbestimmt und zweckentfremdet.
Doch ausgerechnet meine hilflose Wut war die stärkste Kraft, die in mir die notwendige Energie freisetzte. Ich wollte niemals nur der Erzeuger dieses Kindes sein. Überzeugt und anmaßend hatte ich mir zugetraut, beide Rollen zu erfüllen. Infantil, aber entschlossen war ich Vater und Mutter zugleich. Zumindest traute ich mir diese Doppelrolle zu. Insgeheim bildete ich mir ein, stärker und fähiger zu sein als andere Männer. Natürlich hatte ich nicht die intime Zeit der Schwangerschaft mit Emma verbracht, aber ich hatte sie in jenem herrlichen Moment ihrer Geburt adoptiert.
Ist eine Geburt nicht eine der letzten Urgewalten, die wir in unserer kultivierten, technisierten und zivilisierten Kultur noch kennen lernen dürfen? Mit der Geburt von Emma nahm ich Teil an der ewigen Entwicklung des Lebens. Auch solch philosophische Gedanken durchzogen unsere ersten Tage. Plötzlich war ich nicht nur ein Teil, ein Endglied, sondern ich verschaffte mir somit die theoretische Chance, mein Erbgut zu bewahren, die unsterbliche Unendlichkeit. Wenn das auch nur eine hypothetische Möglichkeit war, so ist es doch das menschliche Streben nach „Ewigkeit“. Nichts bringt einen dem Leben näher als die Geburt des eigenen Kindes. Erschreckend aber auch die Gewissheit, somit dem Tode näher zu rücken.
...
© Glaré Verlag
Hier können Sie Ihre Bestellung aufgebenzurück zur Auswahl
![]()
Der andere
Orient 20
176 Seiten. 14,90 Euro
ISBN 978-3-930761-39-5
Leseprobe:
Bauchtänzerin
Als ich klein war, wollte ich Bauchtänzerin werden. Ich sah für mein Leben gern ägyptische Filme, vor allem, wenn dabei viel getanzt und getrommelt wurde. Die Ägypter waren und sind noch heute weit und breit die Meister der Bauchtanzkunst und der Unterhaltungsproduktion in der arabischen Welt. Mich faszinierten die Tänzerinnen mit ihrer Schönheit und der Geschmeidigkeit ihrer begnadeten, zum größten Teil entblößten Körper. Die glitzernden bunten Schleier, die sie in der Luft schweben ließen, um sie dann in einer plötzlichen Bewegung mit einem schelmischen Blick scheinbar nachlässig auf den Boden zu werfen, das harmonische Vibrieren der Hüfte, die wiegenden Schritte, die zauberhaften Armbewegungen, die Art, wie sie den Kopf genüsslich nach hinten schüttelten, dass ihre Haare flogen und wie sie ihr Lächeln voller Lebenslust um sich streuten wie Jasminblüten und damit ihre Zuschauer entzückten. Es faszinierte mich einfach und ich hätte am liebsten ohne Unterlass einen Film darüber gesehen. Selbst wenn er so traurig war und mich mitnahm wie die Verfilmung der Lebensgeschichte der berühmten ägyptischen Bauchtänzerin „Schafika, die Koptin“, die am Anfang des vergangenen Jahrhunderts in Kairo getanzt und gelebt haben soll. Es war für mich ein hinreißender, grandioser Film, bei dem ich gleichermaßen Vergnügen empfunden wie geheult habe, wegen des ungerechten Schicksals der wunderschönen und gütigen Tänzerin, die zu Armut und einem menschenunwürdigen, einsamen Altwerden verurteilt war. Und das einfach nur, weil sie Bauchtänzerin war. Das konnte mein kleiner Kopf beim besten Willen nicht verstehen.
In Tunesien habe ich mir im Sommer, wenn die Hitze nach dem Mittagessen unerträglich wird und den Menschen nichts anderes übrig bleibt, als sich zur Ruhe zu begeben, stets nichts außer einem berauschenden Bauchtanzfilm gewünscht. Wir wohnten im Herzen von Ariana, dem Städtchen am Rande von Tunis, und ich hegte immer die heimliche Vermutung, dass nicht die alte Moschee, sondern unser Haus der Mittelpunkt der Stadt war, da sich die drei wichtigen Landstraßen direkt vor unserer Haustür trafen. Man konnte durch den Spalt der Jalousie sehen, dass sich um diese Tageszeit keine Menschenseele auf die Straße traute, höchstens der Wasserträger hinter seinem trottenden grauen Maultier mit dem türkisfarbenen Wassertank oder der alte, müde Straßenfeger, der den Müll an den Straßenecken zu Häufchen zusammenfegte. Damit sie später, nach Sonnenuntergang, von den spielenden Kindern jubelnd in alle Himmelsrichtungen zerstreut würden. Zu jener Zeit gab es weder Videotheken noch Videogeräte, und neben dem italienischen RAI UNO lief das einzige einheimische Fernsehprogramm nur für ein paar Stunden am Abend. Abgesehen davon ging man mit Filmen sparsam und wohldosiert um. Es gab nur einen ägyptischen Film am Mittwoch nach den Abendnachrichten, der nicht immer ein Bauchtanzfilm war, und eine Serie am Samstagabend, die meistens von einer unmöglichen langweiligen Liebe handelte und die in keiner Weise meinem Geschmack entsprach.
Eine gähnende Langeweile erfüllte die Luft der Siesta. Doch ab und zu gelang es mir, diese verhasste Zwangspause und widerlich stille Mittagsruhe, die mir von den Erwachsenen aufgezwungen wurde, in eine Sternstunde zu verwandeln. Ich besorgte mir ein weißes Betttuch, das ich um meine Hüfte schlang, krempelte mein Hemd hoch bis zur Brust, dass so viel wie möglich von meinem damals noch brettflachen kleinen Bauch zu sehen war, und legte los. Ich war auf einmal der große Stern am Nachthimmel von Kairo. Mein Publikum, das ich mir vorstellte, war begeistert und wie hypnotisiert von meinen Bewegungen und dem Zauber meines Lächelns. Ich schwebte in Harmonie mit den Trommelklängen und dem liebenden Publikum. Ich tanzte und tanzte fast bis zur Erschöpfung, dann musste ich unter dem begeisterten Applaus meines jubelnden Publikums noch eine Zugabe machen, um endlich die Show mit einem leichten Knicks und einem von Schafika abgeguckten dankerfüllten Handkuss zu beenden. Der Beifall des Publikums in meiner Kinderphantasie entsprang meistens irgendeinem realen Geräusch, das das nahe rückende Ende der Siesta ankündigte und das ich unbewusst wahrgenommen hatte, und ich musste mein Bauchtanzkostüm schnellstens ablegen, bevor man mich in dieser Aufmachung erwischte. Als ob ich intuitiv schon erraten hätte, dass keiner mir Beifall und Begeisterung spenden würde, denn in der Tat musste ich diesen heimlichen Wunsch, später einmal Bauchtänzerin zu werden, bald nach einem einschneidenden, verwirrenden Erlebnis für alle Zeiten aufgeben.
Die ersten Junitage trugen in ihrer unablässig an Hitze zunehmenden Mittagsbrise die Vorboten der Sommerferien zu uns. Ich freute mich sehr auf drei Monate lang Nichtstun und nicht in die Schule gehen zu müssen. Die Schule bereitete mir eigentlich keine Schwierigkeiten und ich hatte Freundinnen, die ich dort gerne traf. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, das In-die-Schule-gehen an sich als angenehm empfunden zu haben, außer wenn ich in einen Lehrer glühend verliebt war. Mir waren schon immer geplante Termine, Stundenpläne und Ähnliches zutiefst zuwider, alles, wobei der Uhrzeiger eine Rolle spielte. Und so ist es bis heute geblieben.
Wie dem auch sei, meine Freude war sehr groß, als ich erfuhr, dass ich mit meiner Großmutter bei unseren Verwandten in der nahen Hauptstadt ein paar Tage verbringen durfte. Es gab nämlich ein großes Ereignis, die Beschneidungsfeier des kleinsten Sohnes dieser Familie, und da sie die letzte für die Eltern war, musste ausgiebig gefeiert werden. Mit den Vorbereitungen fingen die Verwandten schon einige Wochen vorher an. In dem alten Haus mit den feuchten, dicken, unebenen Mauern in den engen Gassen mitten in der Medina wurde, so wie es die Finanzen gerade erlaubten, renoviert, die Mauern geweißelt, die Fenstergitter schwarz und die Fensterläden azurblau gestrichen, die Nachbarinnen boten sich zur Hilfe an. Es wurde gewaschen, gekocht, gebacken, gesungen, getrommelt, gejubelt, der Name Allahs und seines gekrönten Propheten gepriesen und das böse Auge der Neider mit Weihrauch vertrieben. Ich fühlte mich wie im Schlaraffenland. Ich konnte wie die anderen Kinder gelegentlich ein Stück von den Köstlichkeiten erlangen. In dem Hof, in dessen Mitte ein quadratisches Beet mit einem Jasminstrauch, einem kleinen alten Feigenbaum und wilden Minzebüschen war, rannten wir im Kreis und spielten unermüdlich.
Die Fröhlichkeit, Unbeschwertheit und Sorglosigkeit dieses Festes war so berauschend, ansteckend und so angenehm süß, fast so süß wie das stibitzte Mandelgebäck. Es blieb bis heute eine farbenfrohe, duftende Erinnerung.
Das tiefdunkle Schwarz der glänzenden glatten Haare des zu beschneidenden Knaben schimmerte durch eine mit Nelken bereitete Paste fast blau, seine mit Henna gefärbten Händchen und Füßchen, seine fröhliche Stimmung und sein unschuldiges ahnungsloses Umherstolzieren bis zu seinen späteren Schreien bei dem Furcht erregenden Beschneidungsakt sind für mich unvergesslich.
Der Tag der Tage trat endlich ein. Der Knabe wurde am Vormittag zum Friseur gebracht, ihm wurden die Haare zu einer Ponyfrisur geschnitten. Anschließend wurde er unter den jubelnden Rufen der Männer im Hof von seiner Mutter und ihren Helferinnen im Ereigniszimmer zur Feier angezogen: Er hatte eine weiße Djebba an, einen blutroten Istambulhut mit einem aus silbernen Pailletten gestickten fünfzackigen Stern mit Halbmond und goldene Schuhe, wie die des Emirs Salahuddin, einer meiner bevorzugten Verehrer in meiner phantastischen, glanzvollen Bauchtanzwelt.
Die Zeremonie begann mit einem Besuch des Heiligen der Medina. Dann wurde ein Rundgang im Viertel mit einer Blaskapelle gemacht, an dem sich nur Männer und Knaben beteiligen durften. Anschließend spielte die Kapelle eine Weile in der Sackgasse vor dem Haus und schließlich kamen alle unter ohrenbetäubenden Jubelschreien und Klängen in den Hof, womit die Feier kurz vor ihrem Höhepunkt stand. Die Musiker spielten ägyptische Schlager, die ich in meinen Siesta-Aufführungen selbst choreographiert und oft genug geübt hatte. Das waren meine Materie, meine Leidenschaft, meine Klänge. Und wie von einem Zauberstab berührt, stand ich auf einmal auf einem der Tische. Mein kleiner, dürrer Körper hatte sich den Klängen voll hingegeben, zweifelsohne wie die großartige Schafika.
Meine Aufführung erntete großen Beifall, aber mir war der erstaunte forsche Blick mancher Erwachsener nicht entgangen. Dieses Publikum war nicht mit meinem phantastischen Siestapublikum zu messen, aber ich fühlte mich trotzdem selig beim Tanzen. Bald knallte eine Amphora auf den Marmorboden und Tonscherben, Bonbons, Nüsse und buntes Kleinkonfekt flogen in jede Richtung und die Schreie des Knaben wurden durch die Trommeln und die Jubelschreie übertönt.
Die Feier ging ihrem Ende zu, alle hatten sie genossen und sich amüsiert, bis auf den armen frisch Beschnittenen, dessen Kopf auf dem Schoß seiner Mutter lag, und der wie ein kleiner Welpe winselte.
Am nächsten Tag, als meine Großmutter und ich anfingen unsere Sachen einzupacken um uns langsam zu verabschieden, hörte ich meinen Onkel in aufgebrachtem Ton zu seiner Frau sagen: „Ich musste mich gestern so beherrschen, um diese kleine Schlampe nicht vom Tisch herunterzuholen und ihr eine saftige Ohrfeige zu verpassen, die sie bis an ihr Lebensende nie vergisst!“
Diese Äußerung, die meine fröhliche Stimmung lähmte und meine Glücksempfindungen in Melancholie und Fragen ohne Antwort für eine enttäuschte Siebenjährige verwandelte, die war hart genug, um mich für immer von einer Bauchtänzerinnen-Karriere abzubringen.
© Glaré Verlag
Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
![]()
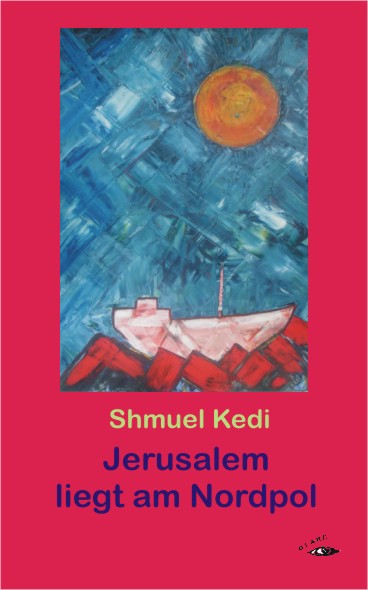
Der andere Orient
25
Leseprobe:
Kapitel 1
Jeder komplexen Verstrickung eilt ein simpler Vorgang voraus. Für die umständliche Entstehung dieses Werkes tragen meine schwäbische Übermutter und Tante Mechthild die alleinige Verantwortung.
Es hat, wie schon erwähnt, ziemlich harmlos begonnen. Der rührende Wunsch meiner Mutter, eines hellen Tages auf ihren Sohn stolz zu sein, erweckte in mir den dringenden Wunsch auf den Zusatz „Dr.“ vor meinem Namen. Dieses Thema wird sich wie ein Leitfaden durch das Wörtergewühl dieses Werkes ziehen. Einfach weil der Trieb, jawohl der Trieb, Muttis Bewunderung zu erwecken, bei Männern als eine der ruinösesten Charaktereigenschaften gilt. Bis in unsere verworrenen Tage hinein schaffte dies noch keiner, der bloße Versuch deformierte scharenweise anständige, maskuline Existenzen zu den merkwürdigsten Berufen überhaupt: Musiker, Autoren, Umweltschänder, Umweltretter, Punker, Auftragskiller, Sklavenhändler und Sklavenbefreier und nicht zuletzt aussichtslose Doktoranden.
Muttis abendliche Märchenstunde vor dem Schlafen, in einem winzigen Dorf in den schwäbischen Highlands, erweckte in mir schon in schwäbischem Kindesalter (bei uns altern Kinder schneller) die Leidenschaft für das erzählte Wort. Tja, dieses ist eine an und für sich feine Sache, die leider ihren Reiz verliert, wenn sie mit einer sinnlosen akademischen Laufbahn gekoppelt ist, die ausgerechnet von einem Klimaanlagenhersteller „gesponsert“ wird.
Die gemeinsame fade Mahlzeit in der Göttinger Mensa mit dem Erzähler Joav Ben Melech aus Tel Aviv dauerte nur zehn – kulinarisch gesehen grauenhafte – Minuten. Es gab Rotbarsch, der nach zu lange missbrauchtem und aufgeweichtem Putzlappen schmeckte. Der übel zugerichtete Fisch lag bis zur obersten Rückenschuppe in verdächtig weißem Schmierfett, was nach dem gedruckten Wort auf dem stets gedemütigten Blatt des Menüs Remoulade sein sollte.
Allen kulinarischen Katastrophen zum Trotz: Zehn Minuten mit einem so imposant aussehenden und zugleich so gütigen und bescheidenen Mann wie Joav, der damals für fünf Semester als Dozent für moderne Nahost-Literatur berufen worden war, genügten mir, um mein Doktorarbeitsthema zu wählen. Nach seiner Rückkehr ins Heilige Land, wenige Monate nach unserem gemeinsamen kulinarischen Trauma in der Mensa, blieben wir in einem nicht sonderlich lebhaften E-Mail-Kontakt, bis sich seine Nachricht über den bevorstehenden Poesieabend in Tel Aviv in meinen Laptop schlich.
„An diesem Abend werden auch meine besten Freunde und Kollegen anwesend sein. Jeder von ihnen ist als Erzähler eine Doktorarbeit wert“, hieß es in jener Mail, die mich veranlassen sollte, nach Tel Aviv zu fliegen, um endlich meine Doktorarbeit zum Thema „Moderne Nahost-Erzählkunst“ mit Zutaten, die direkt aus der Quelle flossen, zügig fortzusetzen. Ein Doktortitel bei Frauen und Männern unter dreißig ist beeindruckender als im Rentenalter – und nicht zuletzt: Muttis gesundheitliche Zukunft sah nicht so rosig aus. Für den Zusatz „Doktor“ auf meinem rostigen Briefkasten war also äußerste Eile geboten.
Drei Erzähler von orientalischer Lebensprägung, die aus zwei verfeindeten Völkern stammen, an einem Tisch in Frieden vereint – ist das möglich? Vorneweg: Nein! Es sei denn, eine vierte Person von unvorstellbarer Authentizität und verbaler Fähigkeit schwingt den Dirigentenstab in ihrer sicheren Hand. Der ominöse Dirigent kann aber unmöglich ich sein! Dirigenten jagen wie irre, nur mit einem winzigen dünnen Stock bewaffnet, unsichtbare Fliegen.
„Zollfreie Artikel, Zigaretten, Parfüm.“
Zollfreie Dirigenten? Ach du lieber Gott, ich sitze tatsächlich im Flugzeug! „Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Tel Aviv. Bitte …“
Seit zwei Tagen schwitze ich durch die Straßen von Tel Aviv, um in martialisch klimatisierten Kaffeehäusern und Malls immer wieder zu erfrieren. Ich friere und schwitze und dusche vergeblich dreimal am Tag dem Poesieabend entgegen. Noch zweimal miserabel schlafen, im höllisch lauten Hotelzimmer, nicht fern von der Promenade, bis zum Poesiemarathon.
Zwei Stunden vor Beginn des Höhepunkts meines Israelbesuchs quält mich die Frage, die jeden deutschen Dorfbewohner von bescheidenem sozialen Rang vor dem alljährlichen Schützenfest plagt: Was zum Teufel soll ich anziehen? Die Höferlings werden garantiert in den allerneuesten und feinsten Textilkompositionen zum Fest erscheinen. „Die Lappen haben ein Vermögen gekostet und obendrein waren sie nur in einer exquisiten Stuttgarter Boutique zu ergattern“, wird Frau Höferling leise verraten und die Augen dreimal in ihren Gruben drehen, um anzudeuten, welcher Stress sich hinter dem vermeintlich harmlosen Begriff „Shopping in Big Town“ verbirgt. Mutti würde mich in Richtung Hau-den-Lukas zerren, um aus sicherer Entfernung zu flüstern: „Verfluchte Angeberin, jawohl, Sohnemann, aufgeblasene Angeber sind die Höferlings. Aber jetzt haust du den Lukas mit dem Hammer in den Himmel. Geh’, geh’ und zeig’ Mutti, was für ein prächtiger Bub du bist!“
Schon beim Eintreten ins Kaffeehaus, das den Namen Sof Haolam, frei übersetzt „Ende der Welt“, trägt, ist mir klar geworden, dass das einzige Wesen, das sich Gedanken über ein Schützenfest-taugliches Erscheinungsbild machte, an diesem Abend ich selbst war. Das Kind, das den Lukas mit dem Hammer nie mehr als einen müden Meter in die Luft schlug, sogar im besten Mannesalter.
Bis zur Unkenntlichkeit verwaschene Che-Guevara-T-Shirts aus den 60-ern und am Hinterteil auffällig lässig hängende Jeanshosen billigster Herkunft beherrschten die recht eintönige Accessoirewelt der Künstler. Bei 35 Grad Hitze noch zur Abendstunde sind anscheinend manche Eitelkeitsableger à la Familie Höferling albern und pathetisch. Schließlich handelt es sich heute Abend nicht um einen Schönheitswettbewerb, sondern um existenzielle Poesie.
Der Nikotinmuff, der mir am Eingang entgegenschlug, stammte seiner penetranten Duftnote nach noch aus alttestamentarischer Epoche und dennoch war sein Gestank existenziell gegenwärtig. Am anderen Ende des Saals saßen sie: drei auffällig gut aussehende Männer, die aus der ewigen Stille geistreiche und witzige Erzählungen zaubern können. Ja, da saßen sie! Selbstsicher und gütig, drei literarisch mächtige Säulen, die die noch nicht vorhandene, prächtige Kuppel meiner Doktorarbeit für alle Ewigkeit stolz tragen sollten.
Der Druse Abu Adel, der einzige Mann mit blauen Augen im Bunde, stammte aus dem Dorf Jarka in Obergaliläa. Wie sein Name durch den Zusatz „Abu“ verrät, ist er der stolze Vater eines männlichen Erstgeborenen namens Adel. Der Muslim Haled und der Jude Joav stammen aus Jaffa und Tel Aviv. Nach eigener Aussage kennen sich die drei schon unerträglich lange.
Die Begrüßung war herzlich direkt und dennoch nicht überbordend, um mich nicht gleich zu Beginn zu überfordern. Ich sollte den nötigen geistigen Raum bewahren, um mit den folgenden Ereignissen verschmelzen zu können. Der Abend war eine von vielen Veranstaltungen, bei denen sich in der Regel 50 brotlose Künstler um einen ahnungslosen Zuschauer scharen, um den allgemeinen Untergang der Poesie in mal rau geformten und mal wohl geschmiedeten Gedichten zu bejammern.
Die von Grund auf so verschiedenen Männer gaben mir vom ersten Moment an ohne Umschweife zu verstehen, dass ihnen ein 50-prozentiger Frauenanteil im Saal – nur aus rein literarischen Gründen versteht sich – lieber gewesen wäre.
„Wer weiß, wer weiß, was nicht ist, kann ja noch werden!“, antwortete ich in sparsamem schwäbischen Pragmatismus. Obwohl mir das Thema Frauenquote im Grunde aus puren literarischen oder hormonellen Gründen völlig schnuppe war. Ich durfte schließlich die kommenden Stunden mit den besten Erzählern des Nahen Ostens verbringen, ein Traum für jeden Doktoranden, ein wunderbares wie auch geschlechtsneutrales Ereignis.
Die Besten? Ist die Qualität eines Erzählers messbar wie vergleichsweise ein Hundertmeterlauf? Sind Bestsellerautoren zugleich die allerbesten Handwerker ihrer Zunft? Nicht unbedingt! Zum ersten Mal in diesem Werk bahnt sich jetzt unter meinen Lesern so etwas wie eine Widerstandsbewegung an.
Also, liebe Widerstandskämpfer, entspannt euch. Wir stürmen die Normandie nicht auf dem Seeweg und nicht aus der Luft. Glaubt einfach jedes Wort, das sich auf diesen Seiten tummelt, bis ihr tapfer und hoffentlich vergnügt die letzte Seite erreicht.
Ob die drei Männer, deren Erzählungen ich in diesem Werk der Öffentlichkeit präsentiere, tatsächlich die Besten sind und wer von ihnen der Allerbeste ist, könnt ihr selbstverständlich am Ende selbst entscheiden.
Kapitel 2
Ich war noch eifrig dabei Berge von fremden Daten aus meiner neuen Umgebung herunterzuladen, als der Abend schon begonnen hatte. Auf einer Bühne unter dem melancholisch erstarrten Bildnis des ermordeten Premier Jitzchak Rabin trug eine junge Künstlerin, deren rätselhafte Schönheit ihr sichtbar lästig war, flüsternd einen Text vor, dessen Inhalt sich immer wieder um bunte Murmeln drehte. Und um meinen Tisch saßen ein Jude, ein Moslem und ein Druse vereint.
Die ersten zwanzig Minuten mit dem Trio waren schon allein einen dreihundertseitigen Band wert. Insbesondere für diejenigen unter euch, die ihr Leben dem Dilemma des Existenzrechts der Juden oder der Araber auf den Trümmern des Heiligen Landes verschrieben haben.
Sie beschimpften einander gekonnt, subtil wie effizient, vereinten sich zu schnelllebigen Duos, die den jeweiligen Dritten für mehrere Minuten mundtot redeten, um bei der zweiten Bierrunde, die aus meiner schmalen Schatulle finanziert wurde, zuzugeben, dass auf dem sinkenden Schiff nur Solidarität zählt, und den Streit könnten sie eigentlich auf später verschieben, weil es sich nach der sechsten Bierrunde besser streiten lässt; und außerdem, was wollte ich so alles von ihnen erfahren, bevor ich zurückdüste, zur fetten und ach so unglücklichen BRD?
Irgendwann fiel dem langhaarigen Mann am Mischpult plötzlich auf, dass sich die flüsterhafte Stimme der jungen Künstlerin seit zwanzig Minuten nur bei Allah Gehör verschaffen konnte, weil nur Allahs Ohren so groß sind wie das Universum.
Die Technik macht es tatsächlich möglich: Der Mann mit dem langen ergrauten Pferdeschwanz schob gekonnt lässig einen Regler und auf einmal erhob sich die Stimme der jungen Poetin trotzend über alle Laute der Nacht.
Was war unser Friede
all diese Jahre.
Bunte Murmeln
in der Hand eines
dreijährigen Kindes.
Wohin ich auch schaue,
es regnet Murmeln.
Rote, gelbe, bunte
farblose
und ich gleite auf
sechs Millionen Murmeln
in die Ferne
... und darüber hinaus.
Murmeln sind rund
Alles was rund war
gleitet auf ewig und davon.
Danke schön.
Der Moslem schaute den Drusen an, der Druse betrachtete mich und den Juden fragend. Und dann brachen wir, und mit uns der ganze Saal, in einen befreienden Lachanfall aus.
Die Umseglung des heimtückischen Kap Horns des Nahost-Konfikts gelang uns vorläufig und wir wurden sogar über die wundersamen Eigenschaften von nur vordergründig harmlosen Murmeln informiert. Jetzt lag auf meinen Schultern, Händen, Fingern, Augen, Ohren und vor allem meinem Laptop die heilige Aufgabe, dem besten Erzähler aller Nächte im Orient zu seinem Thron zu verhelfen und dabei mein kümmerliches Dasein mit einem beachtenswerten akademischen Zertifikat aufzuwerten.
Die Nächte in Erzählerdunstkreisen sind bekanntlich kürzer als anderswo und nichts hasst ein Erzähler mehr als unachtsame Zuhörer. Brachiale Aufmerksamkeit war das oberste Gebot für die kommenden Stunden. Meine Hoffnung, die drei würden sich auf rein demokratischer Basis über die Reihenfolge einigen, in der sie ihre Erzählungen präsentieren, zerschellte an den Rauchbänken der seltsamen Realität diesseits eines Dichterabends. Der Akku meines kostbaren Laptops verlor unaufhaltsam an Kraft, während ich noch immer dabei war tausend neu gewonnene Eindrücke zu sortieren. Ein junger Dichter mit tätowierter Stirn samt prächtigem Nasenring trug fiebernd einen Text vor, der überwiegend von Sardinen, Juden und Arabern handelte, die sich in einer kleinen, heiligen, rostigen Dose zu Tode quetschten.
Die besten aller Erzähler stritten noch immer um das Recht, ihre jeweilige Erzählung nicht als Erster vorzutragen, weil in einer Runde dieser Couleur das Auge des Neiders den ersten Erzähler für alle Zeiten seiner Magie zu berauben droht. Was für ein orientalischer Unfug! Nach einer unmessbaren Zeiteinheit von etwa einem halben Bierbecher und zwei komplett veraschten Zigaretten verstummte die Runde. Drei schweigsame Erzähler lauschten gebannt der Stimme eines etwa 55-jährigen Mannes von äußerst imposantem Erscheinungsbild, frei von Tattoos und Ringen an den falschen Körperteilen. Lediglich ein prachtvoller Oberlippenbart zierte sein braunes Gesicht.
Euer König,
was für ein Geier weilte
in seiner Seele?
Wenn ihr ihm bloß einmal
lauschen könntet beim
Zupfen seiner Harfe.
Er spielte nicht gut,
weil er es aus Frust tat.
Ein König, der nur die Frauen der
anderen begehrte.
Wie unsere Politiker,
sie begehren ständig einen Landstrich,
der den anderen gehört.
Jeder meiner Zuhörer besteht
von den Ohren bis nach unten
aus Arsch.
Schaut bloß, was für Ärsche wir sind.
Danke. Thank you, liebe Kameraden.
Der tosende Beifall, der sich dem anonymen Dichter entgegenhob, schien den Mann mit dem pechschwarzen Oberlippenbart nicht sonderlich zu berühren und die drei fingen an, lebhaft über den brisanten Vortrag zu debattieren.
Der Akku meines Laptops hatte mittlerweile die Hälfte seiner erneuerbaren Energie verloren und der Traum von einer Nacht, an deren Ende ich Mutti und dem Rest der Welt endlich den besten Erzähler aller Zeiten präsentieren konnte, schien mehr als je zuvor auf seinem Recht zu beharren, ein Traum zu bleiben.
„Jetzt reicht es mir, Männer!“, rief ich erstaunlich männlich, wobei ich mit Bedauern feststellen musste, dass mein schwäbischer Akzent meinem Englisch nicht von Vorteil war. Die Männer brachen abrupt ihre sinnlose Diskussion über das Gesäß als leider viel zu selten benutzte Metapher in der Dichtung ab und ich nutzte die Gelegenheit, um ein zweites Machtwort zu sprechen, wohl ahnend, dass mein zweiter Angriff ein Schuss nach hinten oder, ehrlicher formuliert, ein Schuss ins eigene Gesäß sein könnte.
„Es ist einfach unfassbar! Ich sitze in der Gesellschaft von drei brillanten Männern, denen nichts anderes einfällt, als über Lebewesen zu debattieren, die zu neunzig Prozent aus Gesäß bestehen, und das angesichts unserer unwiderruflichen Sterblichkeit. Freunde, vor mir steht ein wundersames Gerät aus Plastik, Plasma und Silikon, das in der Lage ist, zumindest einen wunderbaren Teil eures Daseins in den Zustand der Unsterblichkeit zu katapultieren. Also, Shalom und Salam sollen herrschen an unserem Tisch. Joav, du fängst an, unseres gemeinsamen Mahls in Göttingen wegen. Und möge das Auge der Neider sich nur auf mein eigenes Hinterteil fixieren.“
Ich glaube, die drei waren mit etwas Verspätung dabei, sich mit meinem Dasein auf Erden auseinanderzusetzen. Sie betrachteten mich nun mit freundlicher Neugier, und das war nicht gut. Wenn jemand aus dem Morgenland sein Gegenüber mit zwei solch glühend schwarzen oder braunen Augen anschaut, folgt in der Regel ein detaillierter verbaler Fragenkatalog zu Herkunft, Wohnort, Freundeskreis und Vorlieben der Neugier erweckenden Person. Mit etwas Pech kann dieser Sympathieaustausch eine ganze Nacht dauern, weil man zu jedem Auskunftsdetail ausführliche Gegeninformation bekommt.
„Auskunft zu meinem unbedeutenden Werdegang tief im Schwabenland biete ich später“, rief ich vorbeugend, wobei meine Stimme diesmal Mitleid erweckend stotternd über die Runde eierte. Eine Tatsache, die im Orient auch ihre Daseinsberechtigung hat, weil sich nämlich nirgendwo auf unserem Planeten Barmherzigkeit so wohl fühlt wie hier im Nahen Osten. Joavs große braune Mandelaugen waren glasig und blutunterlaufen. Es schien, als ob der Mann in der Lage wäre auch mit bloßen Augen seine Erzählung vorzutragen. Wie unbedeutsam schienen unser Alltagsnöte in diesem Moment.
Irgendwas stimmte aber nicht in unserer Runde. Der Araber schenkte mir mit einem kurzen Augenblinzeln die Antwort. Es war mein Laptop. Er lag auf einmal so deplatziert auf dem Tisch wie ein Schwein, das es sich in der Kirche bequem macht. Geschwind verstaute ich das hässliche Gerät in meiner Tasche und zauberte ein jungfräuliches 80-seitiges DIN-A-4-Schreibheft hervor, das ich erst vor sieben Tagen zu dem Wahnsinnspreis von nur 80 Cent in der Hannoverschen Straße erworben hatte.
Der Araber nickte beinahe unsichtbar bejahend. Eine Nacht unter freiem Erzählhimmel konnte beginnen!
Die kommende Erzählung hat Joav noch in seinen Göttinger Jahren verfasst. Es handelt sich also eigentlich um eine Story Made in Germany.
Er hat schon angefangen. Deswegen wechsle ich zum Flüsterton.
Wovon handelt sie? Habt bloß Geduld!
Der erste Kuss und das Meer (Erster Teil)
Kalt und grau war es in Nordeuropa, vier Wochen vor dem endgültigen Ende des zweiten Jahrtausends nach der Geburt des Mannes aus Galiläa. Erinnert ihr euch noch? Ganz genau, jene kalendarische Luftblase namens „Millenium“.
Der Fluchtdrang aus dem faden, vorweihnachtlich konfusen Konsumrausch der Massen, samt der wiederholten Frage nach meinen Partyplänen für die einmalige Silvesternacht seitens gelangweilter Freunde und Studenten, die nur darauf lauerten, meine Spirituosenvorräte zu plündern und mein Parkett mit klobigem Tanzbein zu ruinieren, und ein äußerst verlockendes Angebot meines Reisebüros katapultierten mich 10.000 Meter in die Lüfte und dann zurück zur Erde, ins Land meiner Ahnen: Spanien, Sepharad, das Land der Entdecker und Eroberer, Flamenco, Fußball, Wein und Stierkämpfe.
Vieles geschah in unserer Welt seit dem Tag der bitteren Vertreibung der Juden aus Spanien vor mehr als 500 Jahren. Der Strom, das Auto, die Lokomotive, das Penicillin und sogar der unliebsame Pariser wurden erfunden. Die Kartoffel wanderte von Südamerika nach Europa und wurde fast über Nacht zum erfolgreichsten Emigranten aller Zeiten, aber dennoch werde ich bis zum heutigen Tag „Sepharadi“ genannt, die Bezeichnung für die Nachfahren der ehemaligen spanischen Juden. Also handelt es sich bei meiner aktuellen Fluchtaktion nach dem „Last-Minute“-Buchungsprinzip um so etwas wie einen Heimatbesuch mit unwesentlicher 500-jähriger Verspätung.
Der spanische Winter hat eine milde Seele, exzellente Tapas und Weine sowie eine Melancholie, die mir beruhigend vertraut vorkommt.
Die Stadt Cadiz, von deren Hafen in früheren Epochen eine große Zahl von Galeeren zu bedeutenden Entdeckungsreisen aufbrach, ist eine der ältesten Städte Europas, mit zahlreichen und imposanten architektonischen Zeugen einer ruhmreichen Vergangenheit. Diese touristenfeste Tatsache verlor nach wenigen Stunden wegen der etwas weniger ruhmreichen Gegenwart an Bedeutung, angesichts der bitteren Tatsache, dass jede dritte Person in dieser Stadt arbeitslos ist. Die Armut, die hier ihr Unheil stiftet, mal kaschiert hinter zerrissenen Masken aus dem Stolz der Verzweifelten und dann wieder schamlos präsentiert nach der endgültigen Verbeugung vor dem allmächtigen Schicksal, weckt in mir Erinnerungen an Armutstage, die meiner Kindheit in Jaffa bis zum letzten Tag treu blieben. Armut, die ich längst als besiegt glaubte. Armut im Winter. Armut am Mittelmeer:
Mittwoch kam der stotternde Mann von den Stadtwerken des vereinigten Tel Aviv-Jaffa und nach kurzem staccatoartigen Vortrag stellte er uns den Strom ab. Seit Monaten hatte Mutti die Stromrechnung nicht bezahlt, es musste wohl so weit kommen. Jetzt bereiteten wir uns auf die erste Nacht in der Obhut des schummrigen Lichtes der alten Petroleumlampe vor.
Ein ungewöhnlich kalter Winter erinnerte die armen Bewohner am Mittelmeer Ende der 50-er daran, dass es sich im Sommer viel komfortabler arm sein lässt. Man wird nicht so bitter kalt erinnert an die seit etlichen lauen Wintern nicht vorhandenen Jacken oder Pullover. Durchlöcherte Schuhsohlen, die im Sommer als geniale Klimaregulierer dienten, verwandeln sich im heftigen Winter zu verräterischen Wasserpumpen mit einer Vorliebe für scheußlich kalte Regenpfützen.
Das zweite Unglück traf uns eine Woche später. Der dicke, kurzatmige Petroleumverkäufer weigerte sich, meinen Kanister auf Pump voll zu pumpen. Seine Schwäche für Kinder mit traurigen Mandelaugen konnte seine Liebe zu seinen eigenen Kindern und die Angst, wegen Kunden wie uns in der Pleite zu versinken, nicht schmälern. Vier Monate war er treuer Abonnent meines perfekt geprobten wie aufgeführten Vortrags über den baldigen Schuldenausgleich. Eine in der Tat mit der Zeit immer peinlicher gewordene Vorstellung. Jetzt schenkte er mir nur ein verneinendes Kopfschütteln und fuhr mit seinem rostigen Lastwagen fort, auf seiner müßigen Suche nach zahlungskräftigen Kunden in den verregneten Gassen Jaffas.
Strom- und petroleumlichtlosen Nächten am Mittelmeer fehlt es an Anfang und Ende. Es wird weniger und leiser gesprochen und es scheint, als ob die Meereswellen mit dem Segen einer altertümlichen Finsternis immer näher rollen. Die innere Zeitorientierung schöpft ihren Sinn für die Zeit lediglich aus Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Auf einmal steht die Ewigkeit williger denn je zuvor unseren Gedanken und Erinnerungen zur Seite.
Nach einer unbekannten nächtlichen Zeiteinheit, die ich mit belanglosen Gedanken über meinen Alltag als Kind im arabischen Teil von Jaffa verbrachte, zog sich die Route meiner nie vollendeten Gedanken noch weiter zurück in die Vergangenheit, damals noch die junge Vergangenheit eines siebenjährigen Träumers. Heute, etliche Dekaden später, kann ich nicht mit felsenfester Sicherheit feststellen, wann sich der lila König der träumenden Kinder in das Geschehen mischte. In völlig verdunkelten Winternächten jenseits der mit Strom gesegneten Welt dort draußen fällt es hin und wieder sogar dem Geschichtsschreiber von übermorgen schwer festzustellen, wann er endgültig in den Schlaf fiel. Falls die Gelehrten eines Tages herausfinden sollten, dass die kommende Erzählung weitgehend auf Träumen und Ereignissen aus völlig durcheinander gewürfelten Epochen basiert, bitte ich um Verzeihung und mache euch dringend aufmerksam auf die rettende Verjährungsklausel: Sie ist längst erfüllt. Aber nun zurück zu meiner gegenwärtigen Flucht:
Cadiz, Spanien, 1999, etwa 500 Jahre nach der Vertreibung, wenige Tage vor dem Ende eines Jahrtausends.
Ohne die zufällige Begegnung mit Pedro Cesare, dem einäugigen, arbeitslosen Seemann, wäre ich vermutlich nie auf die folgende Erzählung gekommen. Eigentlich begegnete ich dem Mann mit dem starrenden linken Auge in meinem Lieblingscafé in der Altstadt von Cadiz nicht ganz freiwillig.
Geduldig schenkte er mir von seinem Stammplatz an der Theke jedes Mal sein trauriges andalusisches Lächeln, wenn ich mit dem Schreibheft an ihm vorbeiträumte auf dem Weg zu meinem allen verknitterten Kartonfetzen zum Trotz immer wackelnden Stammtisch unter dem von Meersalz zerfressenen Kruzifix, das schief an der kalkweißen Nordwand des Cafés hing.
Am vierten Abend gab ich der noblen Hartnäckigkeit des schifflosen Matrosen nach. Ich lud ihn ein, sich an meinen Tisch zu gesellen. Es war verdammt schwer in seine Augen zu schauen. Es kam mir vor, als ob mir eine Art mythologischer Übermensch gegenübersaß. Sein auffallend großes linkes Glasauge ließ mich keine Sekunde aus seinem streng starrenden Blick und sein lebendiges rechtes Auge sprang pausenlos hektisch in alle nur erdenklichen Richtungen, so als ob es auf eine Bande rachsüchtiger, schwer bewaffneter Piraten lauerte, die auf der Suche nach ihm aus der Dunkelheit zu kommen drohte. So hatte er mich mit seinem linken Auge auf eine äußerst schummrige Art streng im Visier und mit seinem rechten Auge den Rest der feindlichen Welt. Die Gewerkschaft, die ihn im Stich gelassen, der grausame Kapitän, der ihn zur Brotlosigkeit verdammt hatte, der herzlose Wirt, der sein Glas seit zwei Tagen nur gegen Bares nachschenkte, und vor allem die schöne Maria Sanchez, seine tragische erste und letzte Liebe.
Ich ließ es widerstandslos über mich ergehen, drei spanische Nächte lang, in denen ich nicht wagte meine Augen von seinem glasigen Linken zu trennen, denn es könnte seine Ehre verletzen. Drei unwiderrufliche Nächte meines Lebens, in denen ich seinen Leidensweg aufmerksam in mich sog und nicht nur seines gespenstigen linken Auges wegen. Am vierten Abend fing ich an zu schielen, aber ich schloss den mageren, unauffälligen Unglücksraben endgültig in mein Herz.
Ein Name wiederholte sich unzählige Male in seinen Erzählungen: Die schöne Maria, die ihm seinen ersten Kuss schenkte, als die beiden noch zwei kleine Kinder waren, die gemeinsam in dem winzigen andalusischen Gebirgsdorf aufwuchsen. Maria, die ihn kurz vor der geplanten Hochzeit zu Gunsten von Carlos de la Cruz verließ, dem verfluchten, reichen Holzhändler und zugleich sein bester Spielkamerad aus Kindertagen. Maria, deren Schönheit er immer detaillierter und grandioser beschrieb, dreiundzwanzig Mal, bis ich sie samt ihrer dreiundzwanzig Gestalten, die zum Teil völlig verschieden voneinander waren, immer wieder lebendig vor mir sah. Maria, unschuldig lächelnd beim Olivenpflücken an einem von Sonne überfluteten Berghang. Maria, versteckt hinter einem kostbaren cordobesischen Schleier, nur ihre schwarzen Mandelaugen lodern in einer blauen Winternacht, sprühen seelenvernichtende maurische Leidenschaft. Maria, reitend auf einem arabischen Hengst zur alljährlichen, farbenfrohen und rauschenden Fiesta. Maria, die vier Nächte meines Lebens in einen reißenden Fluss aus Tränen und Vino tinto verwandelte.
Am fünften Abend blieb sein Stammplatz an der Theke einsam. Am sechsten Abend nahm trauriger Regen die Gemüter in Beschlag und reinigte die Denkmäler der spanischen Hafenstadt von den zerstörerischen Taubenexkrementen, und es gab noch kein Zeichen von Pedro. Es blieben nicht beglichene Schulden beim Wirt und die Erinnerungen an einen Seemann, der sein Schiff, sein linkes Auge und die schöne Maria verloren hatte. Für einen stolzen, spanischen Seemann schlicht und ergreifend alles.
Pedro und allen verratenen und verlassenen Seemännern aller Epochen verdanke und widme ich die kommende Erzählung.
Der erste Kuss und das Meer (Zweiter Teil)
Hätte es das Lager für Neuankömmlinge „Olim Chadaschim“ – im Grenzgebiet zwischen Jaffa und Bat Yam – nicht gegeben, dann hätte ich mit aller Wahrscheinlichkeit meinen ersten Kuss nicht in einer so frühen Phase meines abenteuerlichen Daseins auf Erden erlebt, und es handelt sich dabei ausdrücklich nicht um einen Kuss, der von den Lippen meiner Mutti stammte, oder den nach Zahnprothesenkleber schmeckenden Kuss meiner lieben Tante Sara.
Moshe aus dem Balkan war ein echter Riese, so habe ich es damals empfunden. Wahrscheinlich, weil er ganze zwei Jahre vor mir in Bulgarien geboren wurde. Ein größeres Kind, das sogar schon im Ausland gewesen war, lange vor unserer die sieben Meere umspannenden Segelära. Ich selbst zählte auch nicht unbedingt zu den Knirpsen im Lager, denn ich war stolze vier oder sogar schon fünf Jahre alt. Das Geheimnis meines genauen Alters in dem Winter, um den es sich in dieser Erzählung handelt, nahmen leider meine Eltern samt einem hohen Berg von offenen Fragen mit auf die lange Reise an das große Ende hinter der Milchstraße.
Moshe oder Moshiko, wie sein Opa ihn nannte, oder Moshon, wie sein Vater in der Regel seinen Namen schimpfte, war ein Kind von enormer Muskelkraft und Visionen. Eines Tages nach dem ersten sintflutartigen Regeneinbruch über unser ärmliches Lager entschied er mit der Hilfe seines Opas, der unter vielen zum Teil recht dubiosen Berufen, die er in der Vergangenheit praktiziert hatte, auch Schreinermeister gewesen sein sollte, ein Floß zu bauen. Ein Floß, mit dem er beabsichtigte, im Regenwassertümpel am Rande des Lagers in die blaue Ferne zu segeln, auf der Suche nach Abenteuern in unbekannten Kontinenten.
Visionen sprudelten nur so im Israel der Fünfziger, im Turnus der vier Jahreszeiten. An den Mitteln, diese prächtigen Visionen zu verwirklichen, mangelte es aber vorne und hinten, denn selbst für das bescheidenste Spiegelei benötigen wir ein Ei und eine Pfanne. Eigentlich auch ein gackerndes Huhn, das die Eier hervorzaubert. Wie ich zu dem Huhn gekommen bin, wird mir für immer schleierhaft bleiben. Also navigiere ich unser Galeere zurück zum Phänomen der nicht vorhandenen Mittel.
Das Dilemma des Auftreibens von Holz für den Bau des Hochseefloßes schien schlicht und ergreifend unlösbar.
Aber wieso? Ihr habt vielleicht Fragen!
Wenn sich mal rein zufällig ein paar Holzbretter ins Lager verirrten, wurden sie sofort von den flinken Kindern der Neuankömmlinge aus Marokko beschlagnahmt und bald verschwand das kostbare Schiffbaumaterial in dem feurigen Schlund des selbstgebauten Lehmofens, in dem die Juden aus Marokko mit dem Segen ihres Rabbiners im biblischen Gewand und dem Furcht erweckenden langen Mosesbart ihr eigenes Brot backten. Das einheitliche moderne Kastenbrot in der neuen alten Heimat konnte trotz der wiederholten Versprechungen des skurril wirkenden aschkenasischen Rabbiners, dass es sich um streng koscheres Brot handle, ihr Vertrauen nicht auf Anhieb gewinnen. Bekanntlich sind Aschkenasim ja die Juden aus Mittel- und Osteuropa, und welcher gescheite Sepharadi neigte damals schon dazu, einem aschkenasischen Rabbiner zu glauben, der in der Augusthitze kettenrauchend hektisch im Lager herumhüpfte, bekleidet mit einem langen schwarzen Mantel, und auf dessen schweißtriefendem Schädel eine bombastische Zobelmütze ruhte? Ganz abgesehen von seiner merkwürdigen jiddischen Sprache.
Fräulein Stella war elend lang und erweckte beim Betrachter den dringenden Verdacht, dass Gott sie aus purer Knochenmasse geschaffen habe. Eine ewige Jungfrau, die den überwiegenden Teil der abwechslungsarmen Tage im Lager in der Lesehütte verbrachte. Eine primitive Holzbaracke, die außer zwei Petroleumlampen, einer Sitzbank und einem Tisch die hundert einzigen Bücher weit und breit verbarg. Bücher, die kaum jemand las oder lesen konnte, außer Fräulein Stella, denn die Bücher waren in neuem Hebräisch gedruckt. Sie war eine rätselhafte Seele, die ohne einen einzigen Verwandten nach Israel gekommen war, unser Fräulein Stella.
An diesem Nachmittag, einem langweiligen Nachmittag von vielen, gesellte sich Moshes Opa, der einzigartige Opa Leon, zu uns, bestens gelaunt und wieder einmal merkwürdig nach Anis duftend.
Dass er unter anderem früher Fremdenlegionär, Seemann und Schreiner gewesen sein sollte, wussten die Lagerkinder längst. Diesmal erfuhren wir, dass er in seiner Jugend zwei volle Jahre am Konservatorium verbracht hatte. Ein begnadeter Geiger sei er mal gewesen, hätte bloß nicht der verfluchte Krieg begonnen und ihm seine sich anbahnende Karriere als Wundergeiger zu Grabe getragen, noch bevor sie begonnen hatte.
Als der Abend seine ersten schattigen Spione ins Lager sandte, um unter seinen Bewohnern die Mittelmeermelancholie zu verbreiten, fing Opa Leon an, über seine kurze, aber erfolgreiche Zeit als hochkarätiger Torjäger in der bulgarischen Fußballnationalmannschaft zu erzählen. Mitten in der Schilderung seines entscheidenden Elfmeters gegen die deutsche Mannschaft brach er seine Erzählung ab. Keines der versammelten Kinder hörte ihm mehr richtig zu:
A: Dieses Kapitel seines mit Ereignissen überladenen Lebens war uns bereits von mehreren nach Anis duftenden Nachmittagen in der Vergangenheit bekannt.
B: Die Stolpersteine auf dem Weg zur Verwirklichung unseres Traums von einem eigenen Floß, mit dem wir auf den sieben Meeren Furcht und Schrecken verbreiten wollten, drückten unsere Laune weit in die unendlichen Tiefen eines schwarzen Ozeans.
Die Rufe meiner Mutti erinnerten mich eindringlich daran, dass ein weiterer Tag sein Ende erreicht hatte, ohne dass ich es geschafft hatte, den alltäglichen Rätselturm zu bewältigen. Geschwind eilte ich zu unserer strom- und fensterlosen Wellblechhütte, denn es gab ja nichts Peinlicheres als die wiederholten Rufe meiner Mutti nach mir. Mühelos vorgetragen in der vierten Oktave, dahinschallend bis über die Grenzen des Staates Israel hinaus.
Vollmond hob sich puderblass über die ungewisse Zukunft des neuen Staates. Die Lagerbewohner waren längst in ihre Träume vertieft, als Opa Leon, der sich den Kummer seines geliebten Enkelkindes sehr zu Herzen nahm, mit leisen Raubkatzenschritten, bewaffnet mit einer Zange und einem Schraubenzieher, zwischen den ärmlichen Wellblechhütten auf dem Weg zur einzigen Holzhütte im Blechwald schlich. Genauer gesagt: zu Fräulein Stellas Lesenest.
Am nächsten Morgen in aller Herrgottsfrühe klopfte und sägte jemand fleißig nicht weit von unserem blechernen Domizil. Das konnte jeder der Lagerbewohner in der sanften Stille des Sabbat-Morgens hören. Jenem Tag, den der Gütige ganz oben als heiligen Ruhetag nach sechs Werktagen gesegnet hatte. Nur ein Mann würde es je wagen, die Sabbat-Ruhe in einem von 20 strengen aschkenasischen und sephardischen Rabbinern beherrschten Lager zu brechen. Er schoss das entscheidende Siegestor für die bulgarische Mannschaft im Spiel gegen die Mannschaft des Dritten Reiches, war ein Fremdenlegionär, der die Gefahr zu seinem zweiten Familiennamen kürte, ein begnadeter Geiger und Schreinermeister – unser aller Opa Leon.
Nach dem blitzschnellen Verzehr meines Spiegeleis gab mir Mutti endlich ihren Segen zum Lossausen. Das tat ich auf dem kürzesten Weg, wieder mal mitten durch den glücklosen Gemüsegarten des alten Herrn Friedmann, bis zu Moshes Wohndose. Dort bastelten, allen Protesten in sechs Sprachen zum Trotz, Opa Leon und sein Enkel seelenruhig am Bau eines prachtvollen Hochseefloßes.
Kinder mit Spiegeleifett schimmernden Backen stürmten aus allen Gassen heran, um dabei zu sein. Vorläufig galt im Lager das Motto: Nieder mit der langweiligen Sabbat-Ruhe.
Abbrum, Moshes Vater, ein kränklich wirkender Choleriker und Apotheker von Beruf, beschimpfte Moshon, seinen unwürdigen Erben, und Leon, seinen unsäglichen Vater, wegen der Schande, welche beide der Familie durch den peinlichen Bruch der Sabbat-Ruhe zufügten. Er beendete seinen verbitterten Monolog und verschwand in seiner Blechhütte. Die Kinder lachten herzlich, aber mir tat der merkwürdige Medizinmischer Leid.
Mittags erschienen in äußerst seltener Eintracht der sephardische und der aschkenasische Oberrabbiner vor dem Bastelduo und versuchten ohne Erfolg, die beiden mit bibelfesten Zitaten von den Vorteilen einer besinnlichen und herzerquickenden Sabbat-Ruhe zu überzeugen.
Um vier Uhr nachmittags war es dann endlich soweit. Das Floß, getragen von fünfzig Kinderhänden, schwebte auf dem kürzesten Weg durch Herrn Friedmanns leidgeprüften Gemüsegarten oder den Brei aus Schlamm und Blättern, der von ihm übrig blieb, zum Regenwassertümpel. Opa Leon, anisduftend und strahlend, marschierte im Fremdenlegionärsschritt hinterher.
Ein großes, historisches Ereignis fand statt, denn nach zweitausend Jahren in der Diaspora stand nun die erste Nachwuchsgeneration von jüdischen Seemännern in den Startlöchern. Die Schöpfung, die die Bedeutung dieses Tages im allerletzten Moment erkannte, fegte geschwind die trüben Winterwolken hinter den Horizont und eine feierliche Sonne erschien prachtvoll am Himmel, um diesem Moment ihr Licht zu schenken.
Just als wir unter der fachmännischen Anleitung von Opa Leon das Floß sachte aufs Wasser legten, erschütterte ein fürchterliches Krachen die Erde. Alle Lagerbewohner, Jung und Alt, die Kranken und die Gesunden, rannten erschreckt zu Stellas Lesehütte. Ein schreckliches Bild der Zerstörung bot sich dort. Die Lesehütte glich einem staubigen Trümmerhaufen.
„Zum Glück war Frau Stella nicht in der Hütte, der Sabbat-Ruhe sei Dank!“, murmelte Opa Leon kreidebleich.
„Und was macht dich so sicher, dass Fräulein Stella nicht doch unter den Trümmern begraben ist?“, schrie krächzend giftig aus schäumendem Mund Moshes Vater seinem rebellischen Vater entgegen. Der marokkanische Oberrabbiner samt biblischem Mosesbart und Gewand war der erste Geistliche am Unglücksort. Fünf der schnellsten marokkanischen Kinder wurde von Rabbi Suisa befohlen, schleunigst zu Stellas Wohnhütte zu rennen.
Nach einem neuen Lagerrekord von fünfundzwanzig Sekunden kehrten die Kinder zurück und stotterten atemlos: „Frau Stella ist nicht in ihrer Hütte.“
Erneut brach Panik im Lager aus. Die Schöpfung, zartfühlend wie eh und je, rief die vertriebenen Wolken wieder her, um dem Geschehen die nötige düstere Kulisse zu verleihen.
Alle nahmen an der Bergungsaktion teil. Die Schlausten mit den abenteuerlichsten Bergungsvorschlägen, das einfache Volk mit Hand und Säge. In einer wahren Sisyphusarbeit wurde behutsam Brett um Brett von dem Trümmerhaufen entfernt. Anschließend türmte sich ein prächtiger Holzhügel auf, der den Juden aus Marokko genügt hätte, ein ganzes Jahr ihr eigenes koscheres Brot zu backen. Nach einer halben Ewigkeit und fünfundzwanzig Minuten bot sich ein Bild, das uns im ersten Moment in Erstaunen versetzte, und das anschließend seinen Platz zugunsten eines kollektiven Lachanfalls räumte, der erste und letzte Glücksmoment in vier öden Lagerjahren. In der Mitte eines Bretterwaldes saß Fräulein Stella unversehrt, friedlich vertieft ins Lesen. Zum ersten Mal in meinem kurzen Leben erfuhr ich die Macht des geschriebenen Wortes. Das Lesen konnte anscheinend manche Erwachsene vor allen langweiligen Momenten und Katastrophen bewahren, die ein Tag für uns Normalsterbliche bereithält.
Opa Leon hatte wohl in der letzten Nacht auf eigene Verantwortung entschieden, selbstverständlich gestützt auf seine Kenntnisse als Schreinermeister am Hof des bulgarischen Königs, dass das Entfernen von nur ein paar Brettern die Stabilität der Lesehütte nicht beeinträchtigen würde. Ein fataler Fehlschluss. Auch zimmernde Wundergeiger und Torjäger können sich wohl hin und wieder irren.
Die Jungfernfahrt verschob sich um ellenlange drei Tage, bis eine zarte Grasschicht über die glimpflich verlaufene Katastrophe am heiligen Sabbat gewachsen war.
Mittwoch, einen Tag vor Chanukka, dem Leuchterfest, war es nun endlich soweit. Alle Lagerkinder, angeführt von Opa Leon, marschierten feierlich zum großen Regenwassertümpel am Lagerende.
Im heftigen Gedränge blieb ich leider außen stehend, denn die Ellenbogenschubs- und Haudisziplin gehörte leider nicht zu meinen ausgeprägten Stärken. Auf dem Floß pressten sich nach altbewährter Ölsardinendosen-Tradition zwanzig zum Teil nasentriefende und fiebernde Kinder. Eine noch nie dagewesene Grippe grassierte im dicht bewohnten Lager. Opa Leon, anisduftend und heiter wie selten zuvor, beruhigte die Skeptiker und Neider, die an Land blieben.
„Zwanzig Kinder trägt das Floß mit Leichtigkeit!“, rief er und brach in ein echtes, lautes Matrosengelächter aus, während er das Floß mit Hilfe eines mächtigen Trittes vom Ufer wegstieß.
Da segelte das Floß ohne mich aufs offene Meer. In den beklemmenden Neid, der mich befiel, mischten sich Bewunderung und Begeisterung. Wie geschmeidig das Floß samt nasentriefender Ladung auf hoher See glitt!
Multitalentierte Opas muss man wohl mit Vorsicht genießen. Sie irren sich leider des Öfteren. Nach nur dreiminütiger, glorreicher Seefahrt in der neuen alten Heimat fing es an Bord des Floßes kräftig an zu blubbern. Anfängliche Glücksrufe verwandelten sich rasch in einen hysterischen Hilfeschreie-Chor. Zwanzig Kinder waren wohl das zweifache kindliche Gute zu viel für die Heilige Stella, wie wir das Floß nach dem Wunder in der Lesehütte getauft hatten. Zuallererst, allen Hochseekonventionen zum Trotz, ging der dicke Kapitän Moshe Moshiko Moshon unfreiwillig zum Tauchgang in das matschige Wasser. Ihm folgten die Offiziere und dann der Rest der Besatzung.
Die grippekranken Matrosen bekamen als Auszeichnung noch eine Lungenentzündung dazu, die gesunden Matrosen eine hoch dotierte Erkältung, und am Abend lobte mich Mutti meiner Vernunft wegen, welche mich davon abgehalten habe, an der glücklosen Jungfernfahrt der Heiligen Stella teilzunehmen.
Nach einer beträchtlichen Anzahl von Backpfeifen und Medikamenten wurden die Krankheiten und die Begeisterung der meisten Kinder für die Seefahrt endlich kuriert. Nur zwei tapfere Seemänner hielten dem Meer die Treue. Kapitän Moshe Moshiko Moshon und ich.
Die Lesehütte wurde nie wieder aufgebaut. Die rasch entstehenden Trabantenstädte im Land kündeten schon vom baldigen Ende der Übersiedlerlager. Die restlichen verregneten Wintertage verbrachten der Kapitän und ich überwiegend auf hoher See. Wir segelten furchtlos in hohem Seegang um das Kap der guten Hoffnung und durch liebliche, sonnendurchflutete Gewässer in der Karibik. Mit zunehmender Souveränität auf dem Floß wuchs in mir, dem einfachen Matrosen, der Wunsch, eines schönen Tages ganz allein in See zu stechen. Ein furchtloser Matrose allein gegen sieben heimtückische Meere. Es wird eine Reise sein, in deren Verlauf ich dem Rest der gediegenen Welt dort draußen beweisen werde, dass auch ich aus dem gleichen Ankerstahl gegossen bin wie die größten aller Seefahrer.
An einem grauen kalten Wintertag, nicht minder trüb als seine Vorgänger, wurden wir mit einem echten Brief mit bunten Briefmarken auf seinem Umschlag benachrichtigt (unserem ersten und letzten Brief in vier genügsamen Jahren im Lager), dass der Kaufvertrag für eine kleine Dachwohnung im arabischen Teil von Jaffa nach der korrekten Überweisung der Gelder an den alten Eigentümer gültig sei. Die neue Wohnung, so hatte mir mein Vater versprochen, sei aus echten Ziegelsteinen, mit Strom und Wasser, das aus der Wand fließt, und Fenster zum Mittelmeer gäbe es auch. Allem Anschein nach handelte es sich diesmal um ein Heim für die Ewigkeit. Meine Tage am Ufer des Regenwassertümpels waren somit gezählt.
Ein Umzug in eine neue Umgebung wäre auch eine sichere und elegante Fluchtmöglichkeit, wenn der Kapitän von meiner illegalen Floßausleihe Wind bekäme. Dieser Tatsache bewusst, rannte ich angetrieben von Heldenmut zu Kapitän Moshes Versteck, in dem sehnlichst ein ozeantaugliches Floß namens Heilige Stella auf mich wartete.
Moshe steckte bis zum Hals in seinem Bett, denn unsägliche Windpocken bohrten sich eifrig in seine Backenhaut. Die Gesundheitskommissarin, eine äußerst elegante Dame aus dem gediegenen und mit echten Steinhäusern versehenen Norden Tel Avivs, hatte seinen Eltern unmissverständlich klargemacht, dass ihr kleiner Moppel sein Bett bis zu seiner gänzlichen Genesung nicht verlassen sollte, da sich in einem dicht besiedelten Wellblechlager ohne örtliche Sanitäranlagen Epidemien rasch verbreiten.
Den ganzen Monolog trug die Kommissarin in bis dato nie gehörtem, feinsten Hebräisch vor, so dass Moshes Eltern, die nur Bulgarisch und Ladino sprachen, die Bedeutung ihrer Worte nur ahnen konnten.
Moshes Pech sollte an diesem Morgen mein ganzes Glück sein. Meine Bronchien pfiffen Protestlieder, mein Herz hämmerte taktlos und wild in meinem Brustkorb, aber es gelang mir ganz allein das prachtvolle Floß ins Wasser zu ziehen. In dem historischen Augenblick, in dem ich meinen linken Fuß auf das Floß stellte, an der grandiosen Türschwelle zum Olymp der glorreichen, unsterblichen Seefahrer und Entdecker wie Vasco da Gama und Marco Polo, tauchte aus den Orangenhainen die schwarzzöpfige Ruth auf. Sie atmete schwer. Ihre Augen sprühten blitzartige Funken und ihre Stimme klang beunruhigend leise.
„Wenn du mich nicht mitnimmst, werde ich sofort zum dicken Moshe rennen und ihm alles erzählen“, flüsterte sie und stellte einen kleinen Fuß, geschmückt mit einem roten Mädchenschuh, auf mein Floß.
Der Opa von Moshon war, wie wir schon erfuhren, auch ein waschechter Seemann gewesen. Von seinen Jahren auf hoher See waren die Tätowierung einer Seejungfrau, deren Anblick bei den Synagogenbesuchern immer Entsetzen hervorrief, und ein weiser Ratschlag übrig geblieben: „Kinder, wenn die Augen einer Frau blitzähnliche Funken sprühen und ihre Stimme heiser und leise wird, dann sucht in aller Dringlichkeit die Ferne!“
An jenem unvergesslichen Morgen verstand ich zum ersten Mal die geheime Bedeutung dieses Ratschlages. Grob gemusterte Winterwolken versammelten sich lauernd am Himmel. Angst und eine große Portion Reue ließen den lang erträumten Moment zu Unglück von erdigem, aber heftigem Ausmaß schrumpfen.
Gott gnade meinen winzigen Knochen, wenn die Tat des Diebstahls zu den von Windpocken überfallenen Ohren von Kapitän Moshe dringen wird. Noch verheerender aber als alles Übel auf dieser Erde war die Frage, wie es meinem Ruf als furchtlosem Seemann ergehen werde, wenn überall bekannt würde, dass ich zu meiner gefahrvollen Seereise mit einem weichbackigen und langzöpfigen Mädchen aufbrach? O Mutti, es war damals schwer, ein Mann von echtem Schrot und Korn zu sein! Und so gab ich mit bleischwerem Herzen der miesen Erpressung nach.
Das Meer begegnete uns mit lausiger Laune, zehn Meter hohe Wellen drohten die Heilige Stella zum Kentern zu bringen. Eisiger Nordwind peitschte erbarmungslos auf mein Gesicht. So vertieft war ich in den Kampf mit dem Sturm, dass ich zu spät merkte, wie Ruth sich mir leise auf Zehenspitzen näherte und mit einem schlangenähnlichem Angriff meine Lippen küsste, ohne mir die Chance zu geben, mich zu wehren. So bekam ich meinen ersten Kuss Tausende von Seemeilen fern der Heimat.
Ich könnte auch detailliert schildern, wie die Hälfte der Kinder aus dem Lager, ein paar hundert Kinder werden es schon gewesen sein, uns in diesem schändlichen Moment beobachteten. Oder wie ich mich in den letzten Tagen vor dem Umzug zu unserer neuen Wohnung, wo ich meinen Ruf als tapferer Mann von Grund auf restaurieren konnte, aus Scham und Angst vor Moshes Fäusten in unserer Wellblechhütte verbarrikadierte und keinen Millimeter von Muttis Rockzipfel wich. Ich könnte euch auch noch berichten, wie sich Mutti angesichts dieses Anfalls von Anhänglichkeit wunderte, aber damit würden wir unwiederbringlich zu einem ganz anderen Regenwassertümpel segeln.
Etliche Jahre danach:
Moshe Moshiko Moshon wurde zu einem waschechten Kapitän, so berichtete es mir sein nach Anisschnaps duftender Opa bei einer zufälligen Begegnung in der Jerusalemallee in Jaffa. Ob es sich bei dieser Meldung wieder einmal um eine Schwalbe aus Opa Leons übereifriger Phantasiewelt handelte? Ich könnte schwören, dass ich den Kapitän vor etwa zwei Jahren samt einem riesigen Bierbauch und locker hängendem Doppelkinn hinter dem Tresen einer Imbissbude auf dem Kamelmarkt gesehen habe. Er schrie in regelmäßigen Abständen nicht etwa: „Alle Mann an Bord, alle Mann an Bord!“, sondern „Falafel Cham, Falafel Cham!“ – Heiße Falafel, heiße Falafel.
Und ich?
Abgesehen von meinem eben geschilderten Abenteuer auf hoher See im zarten Kindesalter blieb ich eine ausgesprochene Landratte und ein lausiger Schwimmer.
Cadiz, Spanien, wenige Tage vor dem Millenium.
Das Wetter hat sich verschlechtert. Beim Betrachten der riesigen und reglosen klobigen Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Cadiz trauere ich meinen Seemannsträumen, präziser gesagt Seeknirpsträumen, jedoch nicht nach. Mittlerweile gelingt es mir meine Nase in stürmischer Nacht fehlerfrei zu meinem Stammlokal zu navigieren.
Es übermannt mich auf einmal der dringende Wunsch, Pedros Trinkschulden bei dem Lokalbesitzer zu begleichen, der Ehre der spanischen Seefahrer aller Zeiten wegen.
Es ist mein letzter Abend in Cadiz. Ein mächtiger Ozeanwind fegt durch die dunklen, alten Gassen und es entsteht eine traumhaft düstere Abschiedskulisse, jetzt, morgen und vor 500 Jahren, am Tag der Vertreibung meiner Vorfahren aus Spanien. Morgen fahre ich ins Landesinnere auf den Spuren meiner Vergangenheit. Es handelt sich nur um eine verspätete Rückkehr. Wie gerne hätte ich alle meine Pläne über Bord geworfen, wenn der gute Pedro samt dem glasigen linken Auge heute hier aufgetaucht wäre.
Was hat die kleine Ruth vor vielen Jahren dazu bewogen, mich auf hoher See zu küssen? Wann hat sich Maria Sanchez in Pedro unsterblich verliebt und wann hat sie aufgehört ihn zu lieben, um ihre Gunst dem verfluchten Holzhändler zu schenken?
Warum verlieben wir uns – nur um vom Himmel der Zweisamkeit in das Tränental der Trennungen zu stürzen? Für die Antworten auf diese scheinbar naiven Fragen hätte ich meinen allerletzten Atemzug gegeben.
Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wieder hier in der Altstadt von Cadiz in Manolos Cafe sitzen, versunken in örtliche Melancholie. Vielleicht wird dann endlich der verschollene Seemann auftauchen. Pedro ist der einzige Mann auf Erden, der die Antworten auf diese eben genannten Fragen kennt.
© Glaré Verlag
![]() Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
![]()
 Sybill-Angelica Zweigert
Sybill-Angelica Zweigert
Sind Sie glücklich?
Eine kreative Annäherung an die Individualität des Glücks
und eine Reise zu sich selbst
218 Seiten. 12,90
Euro
ISBN 978-3-930761-55-5
Leseprobe:
Dieses Buch gibt dem Leser die Möglichkeit, sein persönliches Glück zu entdecken!
Es setzt 12 Fragen zum Glück in Relation zu Herausforderungen und Begebenheiten des alltäglichen Lebens.
Die Autorin ist Malerin und Farbtherapeutin und lebte mit ihrem Mann fast 30 Jahre lang in fernen Ländern und fremden Kulturen. Internationale Entwicklungszusammenarbeit, die Arbeit ihres Mannes, führte das Ehepaar nach Brasilien, zusammen mit ihren zwei Kindern dann nach Syrien, und in den Niger (Nord-Afrika), und nach Benin (Westküste Afrikas) – nach Kamerun (Zentralafrika) wieder zu zweit, da die Kinder bereits erwachsen waren. Die Geschichten, die die Fragen zum Glück einrahmen, lenken den Focus auf die Lebensumstände in den entsprechenden Ländern, die sich manchmal als komisch, ein anderes Mal als kritisch widerspiegeln. Sie zeigen auch, wie viele Facetten Glück haben kann – und dass das, was für den einen Glück bedeutet, für den anderen etwas ganz anderes ist!
In dem Buch werden Fragen zum Glück gestellt, zu denen der Leser aufgefordert ist seine persönlichen Angaben zu machen und Antworten zu finden. Er erarbeitet sich damit einen ganz eigenen persönlichen Erkenntnis-Parcours und kann so seinen individuellen Schlüssel, ein persönliches Glücksmuster entdecken.
Genau das ist das Spezielle an diesem Buch:
der Leser erarbeitet sich hier einen
„eigenen Schlüssel zum Glück“!
Die persönlichen Einträge stellen mit den individuellen Lebensmustern des Lesers ebenso individuelle, eigene Glücksmuster her!
Ein überaus persönlicher Weg ins eigene Glück!
Im Unterschied zu vielen weiteren Büchern auf dem Markt, die sich auch mit der Frage „nach dem Glück“ beschäftigen, wird der Leser auf diese Weise von Anfang an aktiv mit in das Buch einbezogen. Die 12 Fragen zum Glück sind Bausteine und Anleitungen zum „Glücklichsein“, die zahlreiche Erkenntnisse, Bilder und praktikable Anregungen bieten, die individuell umsetzbar sind.
Die Fragen und Geschichten bringen den Leser in Kontakt mit einem Leitsystem, das jeder Mensch in sich trägt – bewusst oder unbewusst!
Das Leitsystem, das Intuition heißt.
Die Glücksfragen, also „die Reise nach innen“, werden mit Geschichten aus den anderen Kulturen, „der äußeren Reise“, inspirierend verbunden.
Dem Buch liegt die Erkenntnis zugrunde, dass:
„Jeder Mensch auf Erden ist, um sich seines Glückes auf seine ganz persönliche
Art und Weise bewusst zu werden“!
Eine Ermunterung, das eigene Sein und Glücklichsein bewusster zu entdecken. Die Ursachen von Traurigkeit und Kummer zu ergründen und Liebe, Wunsch und Wille in Glücklichsein auszugestalten.
Es ist eine Aufforderung zu sehen, „was“ ist, und „wie“ es ist, –
„warum“ es ist, und wie es um einen „selbst“ steht!
„Sind Sie glücklich?“ …
… ist eine Einladung das Leben zu reflektieren und zu genießen,
… sich selbst zu beobachten, „wie“ wir das Leben leben,
um bewusst und einfühlsam zu sein, und um damit glücklich zu sein.
Warum ich dieses Buch geschrieben habe
Bestimmt nicht, weil ich Ihnen von meiner Weisheit – portioniert – ein paar Lehren verabreichen möchte. Nein, das ist es nicht! Es hat mit „teilen“ zu tun. Es hat mit dem Teilen und Mitteilen von Tatsachen und Ereignissen, von „fröhlichen und traurigen“ Begebenheiten, zu tun. Es hat mit der persönlichen Weiterentwicklung zu tun – in dem Wissen, dass immer „beide Seiten“ von Bedeutung sind, die fröhliche und die traurige, die arme und die reiche, um ein Bild vom Ganzen zu zeichnen und um die „Zeichen“ im Zeichnen für wahr zu nehmen!
Ich bin heute dankbar für alle Erlebnisse und Erfahrungen in meinem Leben, auch
wenn ich einige davon zu dem Zeitpunkt, als ich sie machte, als traurig oder als
hart oder sogar als schrecklich empfand. Ich bin dankbar, dass ich eine Familie
habe, mit der und durch die ich die beste Lebensschule erhielt, und immer noch
erhalte, die ich bekommen konnte. Und ich bin dankbar für alle Begebenheiten und
Begegnungen mit Menschen fremder Kulturen und für ihre Bereitschaft sich mir zu
geben, – oder auch nicht!
In dem Sinne von: es ist so, wie es ist!
Ich bin dankbar für alle Freunde, und Menschen, die mit mir verbunden sind, denn
sie bedeuten ein Netzwerk!
Es ist mein Wunsch, einen Teil von dem, was mir gegeben wurde, was ich erfahren habe, was mir von anderer Seite zugetragen wurde, was mir gut getan hat und was mir geholfen hat, weiterzugeben an andere, die etwas davon aufnehmen wollen.
Es ist mein Wunsch, etwas von dem, was in mir ist und das mir immer wieder zu Freude und größerer Einsicht verholfen hat, bewusst in den Kreislauf einzubringen, der Leben heißt – um so immer weitere Kreise zu ziehen!
Es ist die große Liebe zur Schönheit und Vollkommenheit der Natur, der Faszination der Welt, in der wir leben, und der Menschen, Tiere und Wesen, denen wir begegnen, die mich nach den Zusammenhängen suchen ließ. Es sind die Farben und das Licht, die glücklichen – und die weniger glücklichen Momente, mit denen sie in Zusammenhang stehen – und überhaupt der Zusammenhang mit allem, der Sie und mich „als Teil des Ganzen“ beinhaltet.
Ich für mein Teil, ich teile mit Ihnen – und ich teile Ihnen mit, dass ich, – am
liebsten – glücklich bin!
Sind Sie glücklich? – Oder:
Sind Sie sich Ihres Glückes bewusst?
Jetzt werden Sie sich vielleicht mit der Hand an den Kopf oder an das Herz fassen, und sagen: Glücklich sein – glücklich sein, … „was“ ist das? Darüber muss ich erst einmal nachdenken!
Genau – fühlen Sie sich mal ein, und denken Sie mal darüber nach, das ist es nämlich, was ich anrühren möchte mit diesem Buch!
Was ist denn eigentlich Glück?
Was ist für Sie Glück?
Und was ist „glücklich Sein“?
Glück ist etwas in uns, das uns mit Freude leben lässt. Für jeden Menschen sieht Glück, und damit die Freude, anders aus. Glück und Freude sind so individuell, wie jeder Mensch einzig ist. Demnach gibt es zahllose Möglichkeiten zum Glücklichsein, gerade so viele, wie es Menschen gibt auf dieser Erde.
Also ist es schon mal nichts mit dieser „ einen Formel für alle Fälle“, mit dieser allgemeinen Zauberformel zum Erreichen des Glücks, werden Sie vielleicht enttäuscht denken! Leider nein, muss ich da einräumen, – denn für eine solche allgemeine Formel sind Sie einfach zu einzig und viel zu besonders, jede und jeder Einzelne von Ihnen, die Sie diese Zeilen lesen! Wir alle sind nämlich so großartig und so besonders in unserer Individualität, dass eine einzige Formel für niemanden von Nutzen wäre.
Also ist es schon mal nichts mit dieser „einen Formel für alle Fälle“, mit dieser allgemeinen Zauberformel zum Erreichen des Glücks, werden Sie vielleicht enttäuscht denken! Also eher „Millionen Formeln und noch viel mehr“ für ebenso viele Glückssucher oder Glückspilze?
Wir werden sehen!
Mit Ihrer Hilfe und Ihrer Mitarbeit werden Sie (sich) sehen!
Wie das gehen soll?
Gar nicht schwer!
Es könnte z.B. so aussehen:
Sie können Ihre ganz persönlichen Formeln für sich
selbst entdecken!
Sie können sich, während Sie dieses Buch lesen, all das heraussuchen und notieren, was für Sie zutreffend ist. So können Sie sich darüber klar werden, was Ihre Vorstellungen und Ideen vom Glücklichsein waren und jetzt sind, und Sie werden so Ihren ganz eigenen Wegweiser zum Glück entwickeln, der in Ihr ganz eigenes „Sein“ – in Ihr Glücklichsein – mündet.
Ihre eigenen Vorstellungen vom Glück beginnen mit Ihrer persönlichen Liste zu den jeweiligen nachfolgenden Punkten.
Danach stellen Sie sich Punkt für Punkt ihre jetzt gültigen Glücksbezüge zusammen, die Sie sich von Zeit zu Zeit immer mal wieder durch Kopf und Herz gehen lassen können.
Sie können sie dann in ihren Tag einbauen und mit ihnen kommunizieren, und Sie können – jetzt gleich – Änderungen in Ihrem Leben vornehmen – Änderungen, die Sie in ein bewussteres, froheres und glücklicheres Dasein führen können,
zu Ihrem eigenen Plan von Ihrem Glück,
zu Ihrem ureigenen, individuellen Glücklichsein.
Und während Sie das alles noch arrangieren, werden Sie bereits sehen, was sich so von selbst tut.
Und es wird sich etwas tun, zumindest das kann ich Ihnen versprechen!
Bevor es jetzt losgeht mit dem eigentlichen „Tun“, beginnen wir mit dem
„In-sich-hinein-Hören“ – wir üben Intuition.
Füllen Sie bitte den nachfolgenden 8-Punkte-Plan aus, indem Sie einfach und ohne Nachzudenken das eintragen, was Ihnen spontan in den Sinn kommt.
Sie müssen nicht alle 8 Punkte ausfüllen, tragen Sie so viel ein, wie Ihnen gerade in den Sinn kommt, und wenn Ihnen nach Punkt 5 nichts mehr einfällt, ist das völlig in Ordnung.
Anschließend nummerieren Sie Ihre Begriffe nach dem persönlichen Stellenwert durch, auf diese Weise haben Sie vor und hinter Ihrem Begriff eine Zahl.
Markieren Sie ihre Rangordnung hinter den Begriffen sehr deutlich!
Was bedeutet für Sie Freude? Worüber freuen Sie sich?
1 ……………………………………………………………
2 ……………………………………………………………
3 ……………………………………………………………
4 ……………………………………………………………
5 ……………………………………………………………
6 ……………………………………………………………
7 ……………………………………………………………
8 ……………………………………………………………
Jetzt werden die 4 wichtigsten Punkte noch einmal extra
und gut sichtbar als Focus eingetragen:
1 ……………………………………………………………
2 ……………………………………………………………
3 ……………………………………………………………
4 ……………………………………………………………
Welchen Stellenwert hat die Freude in Ihrem Leben?
1 ……………………………………………………………
2 ……………………………………………………………
3 ……………………………………………………………
Es gibt Großrichtungen in den Entwicklungsweisen, die die Menschheit durchlebt, aber „wie“ jeder einzelne von Geburt, Kindheit, Pubertät, Erwachsensein, Liebe, Beruf, Ehe, Kindern, Kirche, Glauben und von der Welt, in der wir leben, geprägt ist, ist ein Mosaik, das so groß und so vielfältig ist wie die fein abgestuften Farbpaletten aller Maler dieser Erde zusammen.
„Wie“ etwas getan, gemacht, gearbeitet, gefühlt, gelebt wird, ist Ihr persönliches Markenzeichen, es ist Ihr Identitätszeichen!
Ich werde Ihnen also keine Gebrauchsanweisung zum Glücklichsein geben, denn die werden Sie sich mit Hilfe dieses Buches und der 12- bzw. 6- oder 8-Punkte-Pläne selbst erarbeiten und erfühlen.
Wohl aber liefere ich Ihnen Anhaltspunkte, Denkanstöße und Betrachtungen zum Leben – Gedanken über Freude und Leid, Lust und Laune, Kunst für Kunst, Leben und Tod – über Macht und Gerechtigkeit, Fürsorge und Bereitschaft, Mitgefühl und Verständnis, Vertrauen und Freundschaft, Eignung und Einigung, Aufnehmen und Abgeben – zu Glück und Glücklichsein,
die Ihre Selbstfindung unterstützen sollen, und zu Ihrem ganz eigenen Sein,
dem „Glücklichsein“ beitragen werden!
Fangen wir also an, Fragen zum Glück
und Glücklichsein zusammenzutragen.
1. Woher kommt das Glück?
2. Wie wird es zum Glücklichsein?
3. Haben wir auf das Glück oder das Glücklichsein eine Garantie?
4. Wo können wir das Glück und die Wünsche bestellen?
5. Wie prompt wird Glück geliefert?
6. Wer ist dafür verantwortlich, wenn es meinen Vorstellungen nicht entspricht?
…
Mit Sicherheit haben Sie noch weitere Fragen zum Glück, die können Sie jetzt auflisten. Und wenn Sie das Buch durchgelesen haben, wird es eine Seite geben, auf der Sie diese Fragen hier für sich beantworten können.
Haben Sie noch weitere Fragen zum Glück?
…
Zurück zu unserem Fragenkatalog, den wir nun Punkt für Punkt betrachten werden! Fangen wir unsere Betrachtungen also beim ersten Punkt der Liste an:
1) Woher kommt das Glück?
Glück ist so individuell, wie jeder einzelne Mensch es ist.
Eine Formel, das Glück vieler Menschen zu beschreiben, wäre mit Sicherheit: ein Lottogewinn, also viel Geld!
Wenn wir denn meinen, mit Geld alles kaufen zu können…!
Aber können wir das? Können wir das wirklich?
Ja, ich weiß – und Sie wissen die Antwort auch, … Sie wissen sie selber am besten! Vieles können wir mit Geld kaufen, aber vieles Lebenswichtige eben auch nicht. Freundschaften zum Beispiel, Zuneigung, echte Liebe und dieses „kleine bisschen“ an … ?????, diese Art von Sehnen, die wir manchmal mit dem Schnipsen zwischen Daumen und Mittelfinger zu verdeutlichen suchen …
Was ist denn dieses „kleine – oder große – bisschen“ bloß? Wie sieht es aus mit diesem sehnenden Gefühl im eigenen Inneren? Die Gefühle, die so schwer zu beschreiben sind, weil wir eben manchmal selber nicht wissen, wonach wir uns sehnen, – aber sie ist da, die Sehnsucht - das Sehnen nach … – es ist einfach da.
„Mach mich glücklich“, – das ist die erste Reaktion und der (Hilfe)-Ruf und die
Aufforderung an den Partner.
Wundervoll – damit fließt ein großer Glücksregen für viele, aber noch nicht alle
Glücksucher sind „gut bedient“ damit!
„It’s from heaven…“, singt die Popgruppe Queen,
„Like in heaven …“, schmachtet Evis Presley,
„Vom Himmel hoch, da komm’ ich her …“, weiß ein altes Weihnachtslied,
„Es ist nicht von dieser Welt …“, haben die Söhne Mannheims herausgefunden!
Das sind nur 4 Liedertitel, deren Reihe mit himmlischen Auskünften sich lang fortsetzen ließe. Das Sehnen nach etwas Wundervollem, Unaussprechlichem, Allumfassenden, – nach etwas, das sich nicht wegschieben lässt und etwas will beziehungsweise „nichts will“ … „diese Sehnsucht“ kommt aus unserem tiefsten Inneren.
Also muss der Himmel etwas mit diesem Gefühl des Sehnens nach Liebe (der Sehnsucht) zu tun haben, und zwar in der Art und Weise, dass er die Liebe und Vereinigung von Partnern abdeckt – und noch weiter darüber hinaus geht, dass er uns sozusagen den Himmel auf die Erde bringt – wenn wir es zulassen!
Welche Begriffe fallen Ihnen jetzt im Zusammenhang mit dem Himmel ein?
Die schreiben Sie am besten alle in den dafür vorgesehenen Abschnitt. Sie erinnern sich noch, wie wir vorgehen? Notieren Sie zuerst alles, was Ihnen in den Sinn kommt, und setzen Sie dann die Nummerierung im Sinne Ihrer persönlichen Wichtigkeit dahinter!
…
Ich weiß ja jetzt nicht, was im Einzelnen auf Ihren Listen steht, das soll auch Ihr eigenes Geheimnis bleiben, aber ich weiß ganz genau, dass sich viele von Ihnen gemüht und gewunden haben, um ein einziges Wort, einen Begriff zu umschreiben oder zu umgehen,
und der ist Gott!
Und wenn nicht „Gott“, dann ein
anderes Wort dafür – vielleicht heilige Maria, Buddha oder Dalai Lama, Allah,
Krischna, Yoganander oder Olurun, oder, oder, oder,
wie Sie ihn oder „es“ auch formulieren
wollen oder titulieren –
alle diese Namen und Bezeichnungen haben ihre Berechtigung und Bedeutung –
und alle stehen in letzter Konsequenz für dasselbe: nämlich ihren Gläubigen
Kraft, Rat, Stütze, Richtlinie, Glaube und Zugehörigkeit, kurz: höchster Rat und
Quelle übergeordneter Liebe zu sein.
Nur die Ausübung der verschiedenen Praktiken der Religion ist sehr
unterschiedlich und zuweilen für andere sehr schwer nachvollziehbar.
„Wie“ – auf welche Weise – viele dieser verschiedenen Glaubensrichtungen praktiziert werden, das zieht viel Beurteilung und Kritik mit sich!
„Wie“ – da ist es wieder, das Identitätszeichen, „wie“ jeder „es“ „für sich regelt“ – „wie“ jeder seinen Glauben und seine Liebe leben will, – „wie“ aufmerksam er (sie, es) arbeitet oder zuhört, – „wie“ freundlich der Mensch sich Menschen zuwendet, – „wie“ viel Achtung zu geben er bereit ist, – „wie“ viel Anteilnahme er seiner Umwelt zukommen lässt, – dieses „Wie“ – das ist ausschlaggebend!
Ausschlaggebend – „nachschlagwürdig“ … Ich sehe jetzt mal nach, was das Lexikon zu nachfolgenden Worten zu sagen hat:
Glück
Günstige Fügung als Schicksal
Der daraus erwachsene Erfolg
Gemütszustand innerer Befriedigung und Hochstimmung,
besonders nach Erfüllung ersehnter Wünsche
Günstiger Zufall
„Er ist ein Kind des Glückes“ = ihm fällt alles mühelos zu.
Glücklich
Vom Glück begünstigt,
Erfolgreich
Ohne Störung
Ohne Schaden
Froh
Innerlich befriedigt
Hoch gestimmt
Erfreulich
Gedeihlich
Vorteilhaft
Schicksal
Alles, was dem Menschen widerfährt:
Geschick, Los, Fügung, Lebensbestimmung
Das menschliche Leben lenkende Macht
Die Gunst – Ungunst des Schicksals
Schicksalhaft
Unabwendbar, vorherbestimmt
„das müssen wir dem Schicksal überlassen“
– hier können wir nichts tun.
...
„Quelle der Liebe“, – bei so vielen schlechten Nachrichten über Kriege, Katastrophen, Terror, Anschläge und Betrügereien fragt sich der Betrachter nachdenklich und schließlich entrüstet: Ist das die immerwährende Liebe – ist das göttlich?
Nein, muss ich da zugeben,– aber menschlich!
Denn die Kriege sind von Menschen gemacht und viele der Katastrophen auch.
Es wird geerntet, was gesät wird – und „wie“ gesät wurde!
Wollen – haben wollen – noch mehr haben wollen…, immer noch mehr haben wollen….,
noch mehr, noch viel mehr, noch größer, noch viel größer, noch höher, noch viel
höher – viel, viel höher – Höhenflug!
Es bleibt manchem schier der Atem weg, bei so wenig Maß und so viel Anmaßung!
Und wir alle wissen, wie so was weitergeht, wenn sich diese Spirale höher und
höher schraubt.
Wer erhält uns dann den Atem? Wer hält uns dann am Atmen?
So viele Namen für eine Kraft?
Welchen Namen soll die Kraft tragen?
Ich werde jene Existenz „die schöpferische Kraft“ oder „das weiße Licht“ oder ganz kurz und einfach „es“ nennen!
Wie ich auf das weiße Licht komme?
Durch die Farben und das weiße Licht,
die sich manchmal so besonders am Himmel zeigen!
Wenn ich durch das Strahlen und Leuchten wie elektrisiert und verklärt in den
Himmel blicke und die Wolken und das Lichtspiel betrachte,
und durch irgendetwas –
dieses schon beschriebene Fingerschnipsen, dieses unbeschreibliche „etwas“,
so angerührt werde,
dass ich nur sagen kann: Guck mal, die Wolken…,
guck mal, was das Licht mit den Wolken am Himmel macht,
wie schön das ist,
wie schön „es“ ist, dieses Strahlen
und Leuchten!
Und es bewegt sich und verändert sich zu Formen und Gestalten und schickt die
Strahlen ganz weit zu uns herunter, bezieht uns in das Schauspiel ein,
zeigt Farben, die sind so weich und so schön, dass man sich „hineinlegen“
möchte,
dass einem ganz eigen – und
anders zumute wird als sonst.
Das Sehnen, die Liebe – das Sehnen nach Liebe – Liebe, die aus einem aufsteigt
und einen durchströmt, überströmt – und sich weiter verteilt …,
„es” liegt was in der Luft, – love is
in the air…!
So komme ich auf das weiße Licht, – und wo Licht ist, da sind auch Farben, denn die Farben kommen aus dem Licht.
Durch Lichtbrechung werden die Farben aus dem weißen Licht in 7 Farbstrahlen aufgespaltet, und diese 7 Farbstrahlen repräsentieren den Regenbogen.
Der Regenbogen als Zeichen und Bund zwischen Himmel und Erde.
Erinnern Sie sich an die Geschichte mit der Arche Noah?
Nach der Sintflut offenbart Gott Noah durch einen Regenbogen sein Zeichen des
Bundes zwischen ihm und der Erde.
Freundschaft und Einigung besiegelt mit dem Regenbogen.
Der Regenbogen als Bund mit sieben Siegeln!
Die Brücke zwischen Himmel und Erde wurde und wird also durch Licht und Farben
gebaut.
Sie haben sicherlich schon einmal über die Bedeutung der Farben gelesen.
…
Diese 7 Farben und Kräfte repräsentieren „es“,
das weiße Licht.
Ich für mein Teil schlage Ihnen jetzt eine kleine kreative Regenbogenwanderung vor, bei der Sie Ihre persönlichen Lieblingsfarben auswählen können, und zwar mit Angabe von Übergangs- und Zwischentönen, was die Bedeutung der Regenbogenfarben in ihrem weitesten Spektrum erst richtig zum Ausdruck kommen lässt.
Der Regenbogen mit seinen 7 Farben, mit allen Nuancen und Pastelltönen wie Rosa, Pink, Koralle oder Apricot, Gold, Oliv, Magenta (rötliches Lila), Königsblau, Saphirblau – mit Hell- oder Dunkeltönen – das volle Regenbogenspektrum.
Danach sage ich Ihnen etwas zu der Bedeutung der Farben.
Viel Spaß beim Auswählen Ihrer Lieblingsfarben, das Prozedere kennen Sie.
…
© Glaré Verlag
![]() Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
![]()
 Manouchehr
Abrontan
Manouchehr
Abrontan
Mein Testament
56 Seiten
8,90 Euro
ISBN 978-3-930761-75-3
Leseprobe:
Mein Freund
wenn ich einmal sterbe vergieße keine Tränen
für mich.....
… spare deine Tränen für die Lebenden auf
denn sie brauchen diese nötiger.
Und wenn Du mich vermisst gehe aufs Klo
und vergieße deine Tropfen dort!
In unserer modernen Zeit
weiß man so lange man lebt nicht was in den nächsten fünf Minuten passiert.
Ich gehöre auch zu der Sorte von Menschen die nichts von ihrer Zukunft wissen.
Naturkatastrophen
die Schnelligkeit der Autos auf der Autobahn
moderne Züge mit erschreckend hoher Geschwindigkeit
Terroranschläge auf unschuldige Menschen
zahlreiche Arten von kalten
lauwarmen und warmen Kriegen
alles das treibt dich näher an einen unnatürlichen Tod heran.
Oh nein
ich möchte auf keinen Fall sagen dass ich Anhänger des Ausspruchs bin
das Leben sei kurz und man müsse es bis zum letzten Augenblick genießen!
Deines und auch mein Leben ist kurz
nicht das Leben
das außerhalb unseres Einflusses existiert
genau wie die Zeit
die nichts mit deiner Armbanduhr zu tun hat!
Dieses moderne Leben in seiner Hochgeschwindigkeit bringt uns dem Tod näher als dem versprochenen dynamischen Dasein. Wenn der unerwartete Tod dich trifft steht sofort deine Identität unter einem großen Fragezeichen.
Wenn du Pech hast sucht jeder nach dem kleinsten Anzeichen dich
einer terroristischen Vereinigung
einer politischen Gruppierung
einer rassistischen Gruppe
einem Kriminellen
einem Dieb oder Drogenhändler oder Taschendieb
.zuzuordnen und mit diesen Verdächtigungen dir gegenüber auch noch Geld zu verdienen.
Und wenn du Glück hast versuchen sie Anhaltspunkte zu finden die aus dir
ein Genie
einen Meister Professor
einen Professor Doktor
einen phantastischen Wissenschaftler
das einzig gute und freundliche Wesen
.machen um auf diese Weise eine Freundschaft
Bekanntschaft oder verwandtschaftliche
Beziehung herzustellen und dein Erbe an sich zu reißen.
Ich
der mein ganzes Leben versucht hat sich von solchen Menschen fern zu halten
sagte zu mir selbst
Komm schreibe ein Testament und befreie jeden von diesen Spielchen und absurden Gedanken.
Gesagt getan!
Ich habe jeweils ein Exemplar meinem Sohn und meinem Freund SamSam gegeben und zur Sicherheit eine Ausfertigung bei meinem Anwalt Prof. Dr. Sillything hinterlegt.
Meine Frau lachte und sagte
- Lass gut sein. Was sind das für Sachen die du da zu Papier
bringst!
Sie zog es vor das Testament erst gar nicht zu lesen.
Ich habe folgendes geschrieben:
Hiermit präsentiere ich im Vollbesitz meiner geistigen und physischen Kräfte
mein Testament....
...
I
Es war ein kalter Wintertag. Es hatte einige Tage heftig geschneit und alles war vereist. Ich wartete auf der Straße auf ein Taxi denn ich wollte zu meinem Verleger fahren und mein Testament in Form eines kleinen Buches drucken lassen. In meiner linken Hand hatte ich mein zusammengerolltes Testament fest im Griff und in meiner rechten Hand meine Pfeife als ich das leere Taxi in der Ferne sah und meine Hand hob. Ich nahm einen tiefen Zug aus meiner Pfeife und genau in dem Moment joggte ein großer muskulöser Mann im Trainingsanzug die Straße entlang rempelte mich heftig an und ich fiel wie ein Stein auf den vereisten Asphalt. Und genau in dem Moment bremste das Taxi das sich mir näherte rutschte auf dem Eis und überrollte mich.
Bumm!
Und genauso einfach bin ich gestorben!
Weil ich versucht hatte meine Pfeife zu retten blieb mein Mittelfinger steif stehen.
Meine Leiche
brachte man ins Krankenhaus stellte sofort meinen Totenschein aus und schickte mich zurück in das Dorf in dem ich gelebt hatte ein europäisches Dorf mit 1100 Einwohnern.
Die Trauerfeier richteten dann die Dorfbewohner auf ihrem kleinen Friedhof aus.
Ich
lag mit einem Anzug und einer Krawatte in schwarz bekleidet im Sarg.
Möge Gott sie nicht selig sprechen
die mir diese Kleidung angezogen haben. Ich weiß nicht wo sie die Sachen herhaben!
Denn ich besaß nur eine hellblaue Jeans einen weißen Wollpullover und einen dunkelblauen Mantel.
Mein rechter Arm schaute aus dem Sarg während mein Mittelfinger ausgestreckt nach oben zeigte.
Die Armen haben es so sehr sie es
auch versucht haben nicht geschafft
meinen Mittelfinger zu beugen.
Sogar meinen linken Arm
dessen Hand das Testament noch immer fest hielt konnten sie nicht an meinen Körper drücken. Also war meine Leiche in einem prunkvollen Sarg mit zwei Armen ausgestreckt in Richtung Himmel etwas merkwürdig anzusehen.
- Um Gottes willen schaut doch mal! Sogar beim Sterben führt er eine Unterhaltung mit Gott.
Das war Dr. Sillythings Stimme der auf seinem Roboter-Rollstuhl saß ständig mit den Stühlen in der Trauerhalle zusammenstieß und sich so seinen Weg bahnend auf meinen Sarg zukam. Er war mein Anwalt und hatte Jura studiert aber er hatte immer den Traum eines Tages einen Roboter zu erfinden. Seine freie Zeit verbrachte er mit Computerarbeiten und seitdem er wegen eines erlittenen Herzinfarkts nicht mehr laufen konnte benutzte er zur Fortbewegung seinen selbstgebauten Roboter-Rollstuhl.
Einige der Nachbarn kamen in die Trauerhalle und waren verblüfft über das was sie sahen.
- Schau ihn dir an. Nicht einmal seinen Tod hat er ernst genommen.
- Wirklich er war immer schon so ungezogen. Einige die mich schon beim Hereinkommen an der Eingangstür in dieser Haltung sahen drehten sich um und gingen sofort wieder hinaus. Ihre Gesichter waren wirklich sehenswert.
- Um Gottes willen schau dir seinen Finger an. Er hat nicht den geringsten Respekt vor uns Lebenden!
Einige kamen ohne mich je gekannt zu haben sprachen entsprechend ihrer Religion einige Gebete und gingen wieder. Also nahmen an der Beerdigung nur einige wenige Menschen teil
Sillything
der Pfarrer
mein Sohn
Meine Ehefrau war auf Reisen. Ihre politische Partei schickte sie von Stadt zu Stadt und auch in einige andere Länder. Meine Schwestern hatten es nicht geschafft aus dem Iran anzureisen. Eine hatte kein Geld. Eine andere hatte Geld aber sagte es würde zu teuer werden mit ihrer vierköpfigen Familie zu kommen mich ein letztes Mal zu sehen und zu verabschieden.
Sie werden ihre Gebete von weitem sprechen!
Die dritte Schwester hatte ebenfalls genug Geld und es gab eigentlich auch kein Problem aber sie musste zu lange überlegen ob sie kommen sollte oder nicht und dann war es für die Anreise zu spät. Meine Mutter hatte Grüße gesendet.
Diese Nachricht übermittelte mir mein Sohn als er neben dem Sarg stand.
- sie wollten dass ich dir das mitteile. Unter uns gesagt Vater: mit deinen Armen die aus dem Grab herausragen hat dein Tod etwas Künstlerisches.
Den Deckel des Sargs konnte man nicht schließen
meine zum Himmel gerichteten Arme ließen es nicht zu!
Und mein Sohn der kreativer ist als ich schlug vor den Deckel komplett abzunehmen.
- der ist bestimmt noch für einen anderen Sarg zu benutzen!
Mit einem offenen Sarg begraben zu werden
bereitete mir Freude.
Ich hörte die Stimme meines Sohnes der da oben stand und in meine Richtung hinab ins Grab sah und ich sah auch wie er mit mir redete.
- Entschuldige Vater dass ich das Exemplar deines Testaments nicht bei mir hatte. Ich kam direkt von der Arbeit. Außerdem dachte ich du hast bestimmt eines bei dir. Samsam habe ich auch nicht gefunden. Sillything war ja wie du weißt immer nur mit seinem Rollstuhl beschäftigt. Deshalb hat sich niemand bereit erklärt dich deinem Wunsch entsprechend zu verbrennen. Ich bin mir sicher es ist nicht so schlecht auch diese Form der Bestattung zu erleben. Pass gut auf dich auf! Bis später Vater!
Sie schütteten Sand auf mein Haupt und das war es dann - Finito.
Ich konnte nicht sagen wie viel Zeit seit meinem Begräbnis vergangen war.
Hier unter der Erde gibt es nicht genug Licht um die Zeiger der Uhr zu erkennen oder Tag und Nacht zu
unterscheiden
aber
ich kann sagen dass es eine sehr lange Zeit gewesen sein muss. Ein überaus heftiger Regen über den umliegenden Bergen überschwemmte das Dorf spülte viele Steine und Gräber hinweg verwandelte diesen wunderschönen und idyllischen Friedhof in eine Einöde und alles was von meinem Grab übrig blieb waren
meine Arme und natürlich
der Mittelfinger meiner rechten Hand!
* * *
Man sagt wenn der Tod kommt
spielen Alter Stellung und Reichtum
keine Rolle mehr.
Der Tod kommt und nimmt dich mit!
Ich sage
wenn das so ist
warum hat er dich noch nicht geholt!?
II
Mein Tod ereignete sich zum zweiten Mal im Iran und das auf sehr natürliche
Weise.
Obwohl
natürlich wie soll ich es erklären!
Ich meine es war kein Unfall im Spiel nur ein Schlaganfall
und ein darauf folgender Herzinfarkt setzten mich außer Gefecht und sofort
trat der Tod durch die Tür und nahm mich mit.
Als ich in den Iran kam musste ich an verschiedenen Sitzungen mit endlosen
Diskussionen und sinnlosen Besprechungen über das Drehen einiger Dokumentarfilme
teilnehmen. Lassen wir mal beiseite dass ich das Schreiben der Drehbücher vor
zwei Jahren schon beendet und sie per E-Mail gesendet hatte und ein ganzes Jahr
auf die Antwort warten musste dass sie meine Schriften bekommen hatten so hat es
dann noch ein weiteres Jahr gedauert bis sie mich einluden um über die Filme zu
sprechen. Doch der vereinbarte Tag kam und
endlich unterschrieben die Herren die Verträge
und gewährten mir einen angemessenen
Vorschuss damit ich mit meiner Arbeit beginnen konnte.
Es war natürlich nicht der Grund dass die ganzen Streitereien während der Meetings zu meinem Tod führten. Ich war so naiv meinen Vertragsabschluss mit meiner Familie zu feiern und habe dabei ganz ehrlich alles in allen Einzelheiten erzählt. Ich war noch nicht fertig als das Gequassel meiner Mutter meiner Schwestern und eines meiner Schwäger laut wurde:
- Was ist mit unserem Anteil?
Erst dachte ich sie machten Scherze mit mir und ich ging darauf ein
- Was seid ihr doch für Witzbolde.
- Witzbolde?
Das war die Stimme des Schwagers der das mit einem fordernden Ton fragte.
- Aber ich dachte dass ihr mit mir scherzt.
Nun ich verstand es irgendwie schon!!!
Seit dem Tod meines Vaters war meine Familie im Iran beharrlich damit beschäftigt die Erbschaft aufzuteilen. Aber da mein Vater keine Reichtümer besaß konnten sie auch nicht viel verteilen und es blieb immer an mir hängen ihre finanziellen Probleme zu lösen.
Nun ja ich war eben der einzige Sohn der Familie!
Fünf Jahre sind seit dem Tod meines Vaters vergangen aber die finanziellen Streitigkeiten bestehen weiterhin.
- Meine Lieben was hat denn mein Einkommen mit der Erbschaft zu tun? Habe ich euch in den letzten 17 Jahren die ich nicht im Iran gewesen bin jemals um Geld gebeten?
Und alle haben unisono geantwortet das mache keinen Unterschied und es sei meine menschliche und muslimische Pflicht auf meine Familie aufzupassen. Ich stand auf und nahm meine noch ungeöffnete Tasche um das Haus zu verlassen.
- Auf Wiedersehen Ihr alle. Ich …
Dann
tauchte meine Mutter vor der Tür auf schwenkte mein Testament in ihren Händen und schrie in Richtung ihrer Töchter und Schwiegersöhne
- Seht her… schaut her... sogar sein Testament hat er auf Armenisch verfasst damit wir nicht erfahren wie reich er ist.
Ich bin aufgesprungen riss mein Testament aus ihren Händen und plötzlich
wie beim American Football
warfen sich alle auf mich. Innerhalb eines kurzen Augenblicks blieben von meinem Testament nur kleine Papierschnipsel übrig
mein Herz hörte
unter dem Gewicht dieser sieben Leute auf zu schlagen
und ich starb.
Natürlicher Tod
wurde von einem Arzt festgestellt und auf den Totenschein geschrieben. Daraufhin haben sie mich 24 Stunden lang in einem Zimmer des Appartements meiner Mutter abgestellt um die Trauerfeier zu organisieren.
Du hättest da sein und das sehen sollen
ihr Weinen
ihr Beileid
wie sehr sie mich vermissen
und wie ich sie nur allein lassen konnte.
Wirklich was soll ich sagen??!!
Mein Sohn hat angerufen sich entschuldigt dass er nicht kommen könne. Bei der Einreise in den Iran müsste er per Gesetz zur Armee und hätte die folgenden zwei Jahre das Land nicht mehr verlassen dürfen.
Meine Ehefrau hätte drei Wochen auf ihr Einladungsschreiben und Visum warten müssen.
Auf jeden Fall
war meine Trauerfeier und Beerdigung diesmal riesengroß.
Es kamen
meine alten Arbeitskollegen von denen ich
20 Jahre lang nichts gehört hatte
aus dem Norden die Cousinen und Cousins väterlicherseits mit ihren Kindern und
Enkeln
aus dem Süden die Freunde
aus dem Westen einige Bekannte
aus dem Osten der Teil der Verwandten die ich 50 Jahre lang nicht gesehen hatte
und …
Meine Mutter wollte solch eine Riesenshow veranstalten
um mir ihre Liebe zu beweisen!
Über meine Verbrennung wurde gar nicht erst gesprochen weil mein Testament nicht verfügbar war und die kleinen Schnipsel sich nicht mehr zusammensetzen ließen. Samsam war seit 30 Jahren nicht in diesem Land gewesen und hatte Einreiseverbot. Sillything traf erst drei Tage später ein. Im Flughafen von Teheran hatte er Ärger mit seinem Rollstuhl. Das digitale Gedächtnis seines Rollstuhls war verschwunden. Als er an meinem Grab erschien sagte er leise in mein Ohr
- Ich kann nicht glauben dass das digitale Gedächtnis meines Rollstuhls verloren gegangen ist ich bin mir sicher dass sie es gestohlen haben. Sie können es für ihre Forschungsarbeiten verwenden und für nukleare Waffen nutzen.
Außerdem wurde mir als Moslem
das Recht auf Verbrennung genommen
selbst wenn es mein persönlicher Wunsch war!
Das Einzige was ich dazu sagen kann ist obwohl meine Trauerfeier prachtvoll war wie stark ich spürte dass ich unter all den Menschen nicht mehr als ein Fremder war.
Nachdem sie mich in drei weiße Leichentücher gewickelt hatten drückten sie meinen Körper langsam ins vorbereitete Grab
es war so eng.
Es könnte um Einiges größer sein.
Die Enge war überhaupt nicht mit meinem ersten Grab
zu vergleichen!
Auf jeden Fall kann ich sagen dass der Strom der Tränen stärker war als der Regen auf dem ersten Friedhof
wobei das nicht nur die Tränen der Gäste
meiner Beerdigung waren
sondern auch die Demonstrationen der Basij Revolutionsgarden und Hisbollah zur Jahresfeier des Irak-Iran Kriegs. Sie lösten eine solche Flut aus dass sich die Zeremonie in einen Trödelmarkt verwandelte und die Gäste meiner Mutter der Einladung des Schwagers in ein Grill-Restaurant folgten um dort Gebete für mich zu sprechen.
Kummer und Trauer!
Es brach mir das Herz nicht von den „Nieder mit Amerika“ Rufen die meine Trauerfeier auflösten auch nicht von der Grillparty
ganz und gar nicht!
Ich war traurig dass sie mein Testament in Stücke gerissen hatten.
Ich konnte nichts dagegen tun.
So ist das Leben!
Viele sind der Meinung dass man nicht hinter dem Rücken eines Toten reden
sollte.
Ich bin der Meinung dass die Toten hinter dem Rücken der Lebenden reden müssen!
...
© Glaré Verlag
![]() Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
![]()
 Susanne Schäfer
Susanne Schäfer
Menschheits-Geschwister
Eine Suche
jenseits aller Grenzen
297 Seiten
15,90 Euro
ISBN 978-3-930761-69-2
"...
dass die Menschen über alle nationalen und
und religiösen Grenzen hinweg miteinander
verbunden sind."
(Martin Reinhard in: Gegenwart - Zeitschrift für Kultur,
Politik, Wirtschaft)
Vorwort
>> Gott gebe mir die Gelassenheit...
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. <<
Friedrich Christoph Oetinger
Als sich vor einigen Monaten erstmals zarte Impulse meldeten, vielleicht einmal einen Artikel oder ein Büchlein zum Thema „Knochenmark-Transplantation“, evtl. inklusive „Blut- und Herzorgan“ zu schreiben, hatte ich noch die Vorstellung von einem eher sachlichen Text, gekoppelt mit ein paar ethisch-menschlichen Fragen.
Eine Hauptintention war eine uneingeschränkt-positive Darstellung dessen, was eine solche Behandlung für viele Menschen bedeuten kann, und dass ich mich im Rahmen meiner Öffentlichkeitsarbeit für die Spender- und Spendenwerbung im Sinne der Knochenmark-Dateien einsetzen wollte. Und natürlich, wie es oft mein Stil ist, wollte ich all diese sachlichen Informationen in meine persönlichen Erfahrungen, die der ganzen Geschichte erst Leben verleihen, hineinbetten. Gern hätte ich den Lesern einen Bericht geschenkt, der mit dem Happyend eines rührenden Treffens mit der Familie meines jungen Knochenmark-Empfängers abgeschlossen hätte, mit einer tiefgehenden Botschaft über Verbundenheit von Menschen jenseits von Volks-, Religions- und Geschlechtszugehörigkeit, ja, die sogar die Altersgrenzen außer Kraft setzt.
Dank des Verhaltens gewisser Einzelpersonen, vor allem aber aufgrund von durch „Ethik-Kommissionen“ (die meiner Ansicht nach diesen Namen nicht verdienen) erlassenen Bestimmungen, verlief dann wieder einmal vieles anders als ich gedacht oder erhofft hatte, so dass diese Geschichte wohl kein trauriges, aber ein „open end“ hat, und dann möge das eben so sein.
(Die rührseligen Storys möge man stattdessen gelegentlich in Tagespresse, Frauenzeitschriften und Fernsehen anschauen, und natürlich im Werbematerial der Knochenmarkspender-Dateien. Spätestens, wenn wieder einmal Geld gebraucht wird, oder beim nächsten Chemo-austherapierten Leukämie-Patienten, der noch keinen passenden Spender gefunden hat, wird solch ein Bericht auch in Ihrer Nähe erscheinen.)
Nun hat es sich in meinem abenteuerlichen Leben, welches man an anderer Stelle beschrieben findet, stets derart verhalten, dass alles, was mich zeitweilig fast zerrissen und in Grund und Boden getreten, letztendlich umso tiefer in die Erkenntnis der Lebens- und Menschenrätsel geführt hat. Wenn immer alles glatt und rund verlaufen wäre – welchen Anlass hätte ich gehabt, in eigener Regie nachzuforschen, neue Aspekte zu entdecken und Fragen zu stellen?
In jeder aufrichtig formulierten Frage, die auf Erden ausgesprochen wird, ist die Antwort im Geistigen bereits enthalten; sie wird immer gegeben werden, früher oder später. Das Problem unserer Zeit ist jedoch, dass die Menschen bereits im jugendlichen Alter, spätestens aber, sobald sie selbst eine Amt-und-Würden-Autoritätsposition innehaben, verlernt haben, Fragen zu stellen.
Da ich trotz alledem während meiner aktuellen Recherchen auch wunderbare Ausnahmen von dieser Regel traf – einige von ihnen werden im Text und auf der Danke-Seite noch erwähnt werden – dass ich Freunde, Bekannte und Fremde aus ganz unterschiedlichen Umfeldern fand, die aufgeschlossen und mitfühlend für diese Themen sind, die mir z. T. lange Gespräche darüber gewährten, gibt mir nun den Mut und die Kraft, die Geschehnisse jener Monate aufzuschreiben.
Glücklicherweise habe ich von Anfang an alles dokumentiert, obwohl ich damals nicht ahnen konnte, dass ich mich erneut als eine Art „Wallraff der Medizin“ (wenn auch diesmal nicht in der Maske des Patienten) betätigen würde – zu sehr stand damals das Überleben, und nichts als sein Überleben, meines „genetischen Zwillings“ im Zentrum meines Denkens, Fühlens und Handelns. Es war das bewegendste Geschehen meines bisherigen vierzigjährigen Lebens; wer meine Vorgeschichte kennt, kann ahnen, was ein solcher Satz aus meinem Munde bedeutet.
Viel zu heilig, um darüber zu schreiben.
Dann, als sich von Monat zu Monat neue Datenlagen und im Zuge meiner Versuche, mit zuständigen (?) Personen ins Gespräch zu kommen, schlimmste moralische Demütigungen ergaben, die eine Wunde fürs Leben hinterließen, wurde mir klar, dass das, was wirklich heilig ist, nicht besudelt werden kann – und dass ich durch diesen Bericht nichts „entweihen“ werde, sondern dass ein Schweigen vielleicht die größere „Sünde“ wäre.
Es wird mich viel Seelenkräfte und geistige Disziplin kosten, all dies noch einmal nachzuerleben, solange die Narbe noch so frisch ist. Doch was uns nicht ganz umbringt, das macht uns stärker und frei, und solcherart gelebte Erkenntnis überdauert selbst den Tod.
Eines sei an dieser Stelle klargestellt: Es geht hier in keiner Weise um „Schuldzuweisungen“ oder darum, in (ver)urteilender Manier mit dem Finger auf einzelne verantwortliche Personen oder eine konkrete Knochenmarkspender-Datei zu zeigen, deshalb werden diese Beteiligten stets in anonymisierter Form erwähnt.
Es geht nicht darum, „schmutzige Wäsche zu waschen“, anklagend über „die Bösen, die Arroganten, die Fiesen da“ zu sprechen, denn für jene sollte man lieber beten:
>> Vater, vergib ihnen, denn sie wissen
nicht, was sie tun,
und sie fühlen
nicht, was sie sagen ...
und vergib uns unsere Schuld - wie
auch wir vergeben ... <<
Ich heiße nicht Michael Kohlhaas, und ich will nicht rachsüchtig irgendjemandem eins auswischen. Es geht mir vielmehr um eine Darstellung der unmenschlichen, nicht mehr mitfühlen könnenden und gleichzeitig zu wirklicher Logik-bis-in-letzte-Konsequenz unfähigen Geistesart, die hinter unserem gesamten Zeitgeschehen steckt, egal ob in der Medizin, der Wissenschaft, der Pädagogik, der Politik, der Wirtschaft und im Sozialwesen.
Menschen und Institutionen, die in Routine und Anonymität erstarrt sind, die einem Wasserkopf von Verwaltung und Bestimmungen dienen, sind naturgemäß anfälliger für diesen unheiligen Geist, der Menschen zu Schlachtvieh degradiert, dessen Körperzellen und -organe nichts weiter als organische Materie darstellen, mit der man nach eigenem Gutdünken und Mammon-hausgebackener „Ethik“ verfahren kann.
Ich gestehe ein, dass meine Persönlichkeit, und wenn ich noch so vorsichtig bin, bei gewissen Menschen seit jeher als suspekt, störend und Übleres angesehen wird, weil ich Fragen stelle, die über den schematisierten Ablauf hinausgehen, und wenn ich als freier, mündiger, selbstverantwortlicher Mensch im Zweifelsfalle meine höhere Moral, mein Gewissen vor Gott als eine wichtigere Instanz als weltliche, regional und zeitlich begrenzte Gesetze annehme. Ein solcher Mensch muss zwangsläufig Sand im Getriebe der oben erwähnten Geistesart werden …
Doch an dem Tag, an dem ich dies hier schreibe, bin ich gestärkter und sicherer als je zuvor, dass ich für diese Ideale, Überzeugung, für die Wahrheit, soweit sie mir als begrenztem Menschen zugänglich ist, ggf. auch deren Feinden ins Gesicht spuckend aufs Schafott (alternativ: Knast oder Klapse) gehen würde. Somit ist diese Geschichte eine rein persönliche, die keinerlei Anspruch auf universale Gültigkeit erhebt – wie könnte sie auch?
Wir sind alle Individuen, ob Patienten, ob Spender, ob Ärzte oder Koordinatoren – ein jeder wird die Dinge auf seine Weise erleben, sofern er oder sie überhaupt irgendetwas bewusst erlebt.
Im „Sonderfall Susie“ sind gewiss vielerlei unglückliche Faktoren und Missverständnisse zusammengekommen, die anderen Spendern nicht passiert sind, doch dann ist es eben so. Für mich gibt es keine Zufälle, und alles, auch der tiefste Schmerz, hat einen höheren Grund und Zusammenhang, auch wenn ich diesen nicht immer sofort erkennen kann.
Ich werde es spätestens im Angesicht des Todes und danach erfahren, so wie alle Menschen, und deshalb brauche ich auch niemanden davon zu überzeugen, der ohnehin nichts von solchen „religiösen Spinnereien“, die in unserer ach-so-modernen und aufgeklärten Zeit bereits als Zeichen für Schizophrenie o. ä. gelten, hören will. (Ich empfehle hierzu wärmstens die Aufsätze von Michael Kiske im Internet, siehe „Literaturempfehlungen“.)
Eine jüngere Parkinson-Patientin schrieb mir kürzlich, nachdem sie für einige Wochen in die Psychiatrie gesteckt worden war: „Alle reden von einem Erlöser, der kommen wird. Und wenn man Jesus dann begegnet und erzählt das, dann glaubt einem das niemand.“
Dieses Buch hat nicht den Anspruch, auch nur eine halbwegs vollständige Beschreibung des technischen Ablaufes einer Knochenmark-Transplantation oder der vielen Erkrankungen, vor allem die des Kindesalters, für die die Indikation einer solch potentiell-lebensrettenden, und doch an die Schwelle des Todes bringenden Behandlung besteht, zu geben.
Erfahrungsgemäß interessiert sich die Mehrheit der Leser ohnehin nicht für gar zu fachspezifische Details, und bei meinen Recherchen stellte ich dann auch fest, dass bei Bedarf bereits eine Fülle von leicht zugänglicher Literatur auf dem Markt, vor allem auch im Internet, zur Verfügung steht. Eine kleine, gut sortierte Auswahl empfehle ich auf der Literatur-Seite; wer tiefer einsteigen möchte, findet darin weitere Quellentipps.
Wenn ich auch bemüht bin, die zahlreichen geführten Gespräche und gelesenen Erfahrungsberichte sowie unumgängliche medizinische Informationen einfließen zu lassen, so kann ich doch bei der Zielsetzung „der Mensch im Mittelpunkt“ letztendlich nur meine subjektiven Erfahrungen, Fragen und Erkenntnisse darstellen, und als solche bitte ich die Leser diese anzusehen. Einen Anspruch auf Objektivität kann ich mir unter den gegebenen Umständen nicht anmaßen, doch wenn einer von Ihnen für auch nur für einen Ausschnitt meines Berichtes ein offenes Herz empfindet, wenn auch nur eine meiner Fragen irgendwo weiter aufgegriffen wird, so ist der Sinn erfüllt.
Der Intention dieses Berichtes völlig entgegen gerichtet wäre es, wenn es so aufgefasst würde, dass potentielle Knochenmark-Spender sich abgeschreckt fühlten, sich registrieren zu lassen. Damit würden sie die Falschen treffen, nämlich die auf Hilfe angewiesenen Patienten.
Mein Enthusiasmus für das Blut-, Thrombozyten- und Knochenmarkspenden ist ungebrochen, wie meine Entscheidung für die erneute Registrierung, nur bei einer anderen Datei, am vorläufigen Schluss dieser Geschichte, mehr als Worte demonstriert. Ich würde alles jederzeit und mit der gleichen Hingabe wieder genau so wie im August/September 2006 machen, unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft des Empfängers.
Alle Menschen sind letztendlich Brüder und Schwestern, und in der heutigen Zeit zählen Verbundenheiten aus dem Geiste heraus mehr als so manche Blutsbande. Und dennoch … es kommt mir so vor, als seien solcherart „genetische Zwillinge“, die einander Knochenmark geben können, ganz besonders nahe Menschheits-Geschwister.
Es ist möglich, dass sich nicht jedem der Zauber eines solchen Gnadengeschenkes sofort erschließt, doch ich behaupte, dann hat man sich noch nicht hinreichend bzw. auf der entsprechenden Ebene damit befasst. Vielleicht können die folgenden Kapitel hierzu ein wenig Anregung geben
Auch wenn ich die Lüge nicht „Wahrheit“ nennen kann und gewisse Missstände nicht verschweigen werde – mein Wunsch wäre es, nichts zu verteufeln, sondern dazu beizutragen, dass man sich einmal mit bisher nicht beachteten Aspekten der Transplantation befasst, dass vielleicht einige Verantwortliche, aber auch Betroffene, die sich mit diesen Fragen noch nicht beschäftigt haben, etwas zum Nachdenken angeregt werden.
Ich schreibe nicht gegen, sondern für etwas – z.B. für mehr Zusammenarbeit, für Kommunikation von Mensch zu Mensch, und letztendlich auch dafür, dass möglichst noch mehr Patienten „ihren“ Zwilling finden und dann nach geglückter Knochenmark-Übertragung lange und wirklich ausgeheilt ihre individuelle Lebensaufgabe erfüllen können.
Ursprünglich kam ich fragend-suchend, offen-lernwillig und als Bittstellerin zu gewissen offiziellen Stellen.
Dieses Buch müsste nicht geschrieben werden, hätte man mir von verantwortlicher (?) Seite her beizeiten ein Gespräch Auge-in-Auge gewährt.
Aber okay, dann sei es so, umso gründlicher werde ich alles hier darstellen …
Wäre alles immer glatt gelaufen, wäre mir jeder Schmerz erspart geblieben, was hätte ich lernen können?
Ohne Hemmnisse und Herausforderungen wäre keines meiner Bücher je geschrieben worden. Und dieses Mal ist es die geistige Kraft meines „Zwillings“, wo immer er gerade sein mag, die mir den Rücken stärkt.
In Hingabe
Susanne Schäfer
(während der 40 Tage nach Ostern 2007)
...
Prolog 1966 ... Kometenkind
>>Looking
in a child’s eyes,
there’s no hate and there’s no lie,
there’s no black and there’s no white<<
aus dem Song „Celebrate youth“
von Rick Springfield
Eine 24 Jahre junge Mutter schenkt in Düsseldorf an einem stürmischen, grau-bewölkten, kalten Novembervormittag ihrem ersten Kind das Leben. Die Atmosphäre ist gesättigt vom Meteoreisen des Jahrhundert-Maximums des Leonidenschwarmes. Ein gesundes Mädchen mit einem stattlichen Geburtsgewicht von 3500 Gramm, schwarzen Haaren und mandelförmigen dunkelbraunen Augen; die Haare werden sich später etwas aufhellen, die Augen bleiben dunkel. Es ähnelt eher der Großmutter väterlicherseits, die dann später auch zur Lieblings-Omi wird.
Eine eindeutig „deutsche“ kleine Familie, mit deutschen Ahnen, mindestens bis hin zu den Urgroßeltern – aber so genau interessiert das auch niemanden zu dem Zeitpunkt. Das Leben stellt genug andere Fragen, Herausforderungen und Aufgaben. Das Kind wird katholisch auf den Namen Susanne getauft – und seit es ca. drei Jahre alt ist, spreche ich von ihm als „Ich“.
Zu der Zeit kann ich bereits lesen, schreiben und rechnen, eine religiöse Erziehung gibt es hingegen nicht, weil die Eltern in einer Glaubenskrise sind. Keine Seele, keine Engel, keine Feen, Elfen und Wichtelmännchen. Bestens gerüstet für diese Intellekt-dominierte, materialistische Zeit, trete ich bereits mit fünf Jahren die Schullaufbahn an, nicht immer ein „normales“ Kind, doch schlau genug, mir das nicht über Gebühr anmerken zu lassen und alle sich öffnenden Nischen und Schlupflöcher auszunutzen. Im Alter von sieben Jahren kommt ein Brüderchen dazu, das ich über alles liebe. Es sieht ganz anders aus als ich: knallblaue Augen, fast blonde Löckchen, und ebenso verschieden ist sein Wesen und Temperament.
Wenn nicht die vielen Nachweise bestünden, die mich zweifelsfrei als das leibliche Kind meiner Eltern ausweisen, dächte ich oft, ich komme eigentlich von ganz woanders her; aus einer anderen Familie, von einem anderen Planeten. Wenn ich mich nicht still zurückziehe, bin ich ein oft mein Umfeld nervender, ausdauernder Geschichtenerzähler und fanatischer (freundlicher ausgedrückt: hingebungsvoller) Wissenschaftler. Alles muss bewiesen und dokumentiert sein, sonst hat es keine Gültigkeit.
Mit einem semi-fotografischen Gedächtnis, welches aber nur dann wirkt, wenn mich etwas wirklich interessiert (und das sind im Laufe der Jahre abwechselnd fast sämtliche relevanten Gebiete der Naturwissenschaften u.v.m.), fresse ich schier halbe Bibliotheken in meinen „Speicher“ hinein, und es bedeutet mir nichts. Meine Geschichten und Träume sind voller Details, und wenn man mich ausreden lässt (was aber selten der Fall ist), komme ich immer auf den roten Faden zurück, wie in den Erzählungen aus „Tausend und einer Nacht“.
Nach dem Abitur, während der Lehrzeit, stellt ein Werkstattmeister des feinoptischen Betriebes fest: „Bei dir ist wohl alles ganz intensiv!“ Treffender kann es auch kein geschulter Psychologe ausdrücken; mein Gefühlsbarometer geht in alle Extreme, und jeder kann es sehen.
Viele Jahre später erkläre ich spontan einer Transfusions-Medizinerin, dass ich nicht trotz, sondern wegen dieser starken Gefühle, polar zum geschulten Intellekt, der denkbar gesündeste Mensch sei, auch wenn die gesellschaftliche Norm das anders sehen würde. Nur das, was vollgefühlt und nicht unterdrückt wird, kann auch wieder gehen – und es führt dann kein gespenstisches Eigenleben im Unterbewusstsein mehr! Dennoch gibt es manchmal Momente, da zerreißt es mich fast … doch was einen nicht umbringt, das macht einen umso stärker.
Erst dasjenige, was gelebt ist, hat Transformationspotential und Schöpferkraft!
Ich falle immer wieder auf die Füße – und dieses Buch hier ist geboren aus dem umgewandelten Schmerz einer größtmöglichen Herzenswunde.
Doch nichts, was wirklich heilig ist, kann je entweiht werden.
Rückblende 1989 ...
Norwegen und die Hubschrauber
>>Beredt
til døden alltid vær,
den kommer når du minst den tenker nær.<<
Johan Herman Wessel
(Sei allzeit gefasst auf den Tod,
er kommt, wenn du ihn am wenigsten erwartest.)
Die Lehrzeit und ein Berufsjahr liegen hinter mir, und nun bin ich für fast zwei Jahre in Sachen „Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste e.V.“ im Ausland, den größten Teil in Norwegen, nahe Stavanger im Südwesten des Landes. Riskatun, eine Wohn- und Reha-Anlage für ca. vierzig mehrfach behinderte Bewohner; hier muss ich vielerlei Tätigkeiten ausüben, die ich eigentlich gar nicht kann, aber irgendwie geht es doch.
Gegen Kost und Logis und mit viel Idealismus geht es ans Autofahren (auf norwegischen schmalsten Bergstraßen!), Teller waschen, Müll einsammeln, Windeln wechseln, Kotze aufputzen, Zwei-Zentner-Frauen mit cerebralen Lähmungen duschen, Backen, Stricken, Animateur und Gitarre spielen, Rollstuhltanz, Kioskverkauf und Essen reichen; manchmal auch allein verantwortlich „schwarz“ die Nachtschicht übernehmen, für gute norwegische Kronen. Die Landessprache hatte ich, wie so vieles, was mir nur hinreichend brennt, binnen vier Monaten fließend per Kassettenkurs gelernt.
Anfang November dann ein fast traumatisches Erlebnis: Ich habe Morgenschicht. Magne, ein erst vierzigjähriger, äußerlich stiller, bescheidener Bewohner (Epilepsie, CP und Diabetes) mit einem reichen Seelenleben und enormem Wissen über klassische Musik, hat Atemprobleme. Tove, die Krankenpflegerin im Dienst, und ich packen ihn mit seinem Rollstuhl in den Kombi. Tove steuert, ich sitze hinten bei Magne, bei Glatteis auf der Autostraße nach Stavanger, wo das nächste Krankenhaus ist, als Magne plötzlich zusammensackt.
Ich rufe nach Tove, unsicher, ob es sich nur wieder um einen seiner epileptischen Anfälle handelt. Tove bremst, springt zu mir in den Laderaum, untersucht Magne in Eile, ruft: „O Gott, er stirbt!“ – und ein verheerender Schreck fährt mir in alle Knochen hinein, umso intensiver, weil unerwartet.
Tove leitet mich an, Magne, dessen Herz ausgesetzt hat, wiederzubeleben zu helfen. Alles Geschehen ist wie zu einem Bild gefroren, in dem die Zeit still steht oder in einem völlig ungewohnten Schneckentempo voranzukriechen scheint.
– Ich kann das nicht, das hab' ich nicht gelernt!
– Doch! Immer, wenn ich sage „Jetzt“ (Nå), musst du ihn beatmen!
Tove drückt auf Magnes Brustkorb, mit großer Kraft, zählt die Sekunden …
– Nå!
Ich versuche, meine Atemluft in Magnes verkrampften Mund zu drücken …
– Nå!
Ich huste – „Brød!“ Ich habe die Reste der kurz zuvor von Magne gekauten Brotschnitte in den Hals gekriegt.
– Nå!
Ich gehorche wie in Trance, schlotternd und schluchzend am ganzen Körper.
Magnes Herz schlägt wieder, er atmet. Tove sagt, ich soll ein Auto anhalten, während sie bei Magne bleibt. Wir brauchen einen Rettungshubschrauber!
Ich taumele, immer noch hustend und mit beiden Armen fuchtelnd, brüllend auf die Straße – viele Wagen sind nicht unterwegs (wir sind in Norwegen!), doch der nächste hält an. Norweger sind sehr hilfsbereit!
Ich rufe um Hilfe, bitte, er stirbt, und der Fahrer versteht sofort den Ernst der Situation. Wie ein Wunder, er hat ein riesiges Mobilfunkgerät dabei! (Wir schreiben Ende der 1980-er Jahre, da gibt es noch keine Handys!) Schon bald kommt mit klatschenden, extrem lauten Rotorblättern der Rettungshubschrauber, der Magne nach Stavanger bringt.
Auch wenn ich denke, ich habe alles falsch gemacht: Zu diesem Zeitpunkt lebt er!
Im Auto auf der Rückfahrt atmen wir fast schon wieder auf, zitternd wie Espenlaub, zu erschöpft, um „stolz“ zu sein.
Jetzt wird alles gut werden, jetzt, wo er erst mal im Krankenhaus ist, mit all den geschulten Ärzten und der hilfreichen Technik!
Zwei Stunden später, wir sitzen gerade zur Besprechung mit den Hilfspflegerinnen der Abendschicht, kommt ein Anruf aus Stavanger: Magne ist an einem weiteren Herzinfarkt gestorben.
Ich habe noch immer den Geschmack von Brot und ungeputzten Zähnen im Mund, doch jetzt kommt es mir fast hoch aus Schock über das, womit ich, mich in falscher Sicherheit wiegend, nicht mehr gerechnet hatte.
Magnes älterer Bruder lädt mich zur Beerdigung ein; noble Gesellschaft, von denen wohl die wenigsten zu Lebzeiten Interesse an Magne gezeigt haben. Binnen vier Tagen habe ich einen schwarzen Pullover extra für diesen Anlass gestrickt. Auf dem Friedhof ist es ungefähr so wie an dem Tag meiner Geburt, nur noch kälter hier in Norwegen. Es ist die erste Beerdigung, an der ich teilnehme (mit Ausnahme der von der Oma mütterlicherseits, die ich halb verschlafen hatte), und mir laufen Rotz und Tränen wie sonst was.
Bin ich schuld an Magnes Tod, weil ich zu lahm und falsch beatmet habe? Weil mich grundsätzlich der Atem anderer Menschen schon immer geekelt hat? Mörder!
Unterlassungssünde?
Alle sind besonders lieb zu mir.
Wenige Tage später kommt erneut der Hubschrauber, diesmal direkt auf Riskatun. Irgendetwas ist mit Jan-Ove, einem 25-jährigen, geistig zurückgebliebenen „großen Kind“, das keiner der Bewohner richtig lieb hat, und das Personal ebenso wenig. Jan-Ove hat eine Stoffwechselerkrankung, ist extrem fettleibig, das männliche Geschlecht nur ansatzweise feststellbar, und meistens keift er mit hoher Fistelstimme darum, dass es nicht genug zu essen gibt, bricht dann oft in Tränen aus.
Klatschende Rotorblätter … Flashback; ich gerate fast in Panik; dieses Geräusch ist so assoziiert mit dem Tod, und mit Schuld am Tod, mit Unterlassungssünde! Dasselbe wie letzten Donnerstag!
Lutie, die Hilfspflegerin aus Trinidad, hält mich im Arm, schreit, um den Lärm zu übertönen, auf mich ein, dass sich nicht immer alles wiederholen muss, was einmal schlimm war. Ich schluchze:
– Dasselbe wie am Donnerstag, o nein!
– Sei doch ruhig, das war am Donnerstag, aber heute ist Dienstag! Vielleicht erlebst du heute einmal etwas Schönes stattdessen …
Es sind genug andere Helfer da; ich laufe ins Hauptgebäude zurück. Der MS- und Schizophrenie-kranke Oddvar kommt mir im Rollstuhl entgegen, fragt mit lahmer Stimme und klarstem Durchblick: „Ist es Jan-Ove?“
In diesem Moment geht auch Jan-Oves kurzes Leben zu Ende. Auch der Dienstag hat kein „schönes Erlebnis“ gebracht.
Noch nie zuvor war mir so deutlich klar geworden, wie schnell der Tod einem wie nahe treten kann – gerade dann, wenn die Präsenz von professionellen Helfern Sicherheit zu versprechen scheint.
Rückblende 1992 ...
Christian hat Leukämie
>>
But history is written by those
who have hanged heroes .<<
Aus der Einleitung zum Film „Braveheart“ von und mit Mel Gibson
Die ersten ein bis zwei Jahre wieder zurück in Deutschland sind mit allerlei Schwierigkeiten verbunden. Wegen veränderter Wirtschaftslage weht auch in der Bad Kreuznacher Optik-Firma ein schärferer Wind, meine schon lange bestehenden körperlichen Symptome bedürfen allmählich einer medizinischen Abklärung, im Familien- und Bekanntenkreis interessiert sich keiner für meine Zeit in Norwegen; nichts ist mehr, wie es vorher war.
Der größte Schock war beim ersten Treffen mit Gerhard, einem Freund vom ehemaligen Vogelschutzverein, den ich bereits zur Lehrzeit liebgewonnen hatte, die Eröffnung, dass sein Sohn Christian an Krebs erkrankt sei, genauer gesagt, an Leukämie. (Das war 1990, da war der Junge erst vierzehn.)
Gerhard sagte das ganz ruhig, doch ich kenne ihn von vielen früheren gemeinsamen Aktionen und Exkursionen in der Natur her gut genug, um zu ahnen, wie es in ihm innen aussah. Schlagartig schämte ich mich in Grund und Boden: Hatte ich doch gehofft, mit ihm, einem Sonder- und Hauptschullehrer, sowie seiner Frau Anni, einer sehr professionellen Psychologin, die auch zu allen möglichen Themen Vorträge und Kurse in der Stadt hält, meine vergleichsweise kleinkarierten Problemchen zu besprechen. Ich steckte Gerhard einen Zettel zu: „Gegenüber Deinen Sorgen sind meine verschwindend klein!“
Nun ist es Anfang 1992, Christian geht es nach überstandener Chemotherapie gut, und wir machen eine Wartungsaktion der Vogel-Nistkästen im Appelbachtal. Die stehende, feuchtnebelige Januarkälte kriecht mir in die Knochen, macht mich steifer und müder, als ich es ohnehin schon bin. Christian springt wie ein flinkes Eichhörnchen die langen Leitern herauf und herunter, wirft die alten Nester heraus, entdeckt einen Siebenschläfer, während ich kaum die Kraft habe, die Leiter festzuhalten, geschweige denn, hinaufzuklettern.
Der liebe, alte Herr Meyer flößt mir heißen Tee mit Rum aus einer Feldflasche ein, damit ich überhaupt noch zum Haus von Gerhards Familie laufen kann. Selbst dort drinnen im Warmen werde ich stundenlang nicht wieder fit. Erst Jahre später finde ich ein Wort für diesen Zustand: Körperkernfrieren.
Was ist nur mit mir los? Als Kind erlebte ich das genaue Gegenteil, habe weder Hitze noch Kälte gespürt.
Für Februar steht ein stationärer Aufenthalt zwecks Diagnostik (unter anderem mit Verdacht auf MS, Muskelschwund o.ä.) in einem neurologischen Krankenhaus an. Eine scheußliche Zeit, aber auch eine, die mich lehrt zu leben, wenn man evtl. nicht mehr viel zu verlieren hat.
Christian ist da ein bewunderungswürdiges Vorbild: Leukämie kann schneller tödlich enden als die meisten Formen der sog. neurologischen Erkrankungen – und er macht einfach weiter wie bisher, so gut es geht. Er besucht Schule, Jugendtreff und Freiwillige Feuerwehr, spielt Schlagzeug, will bald den Motorradführerschein machen.
Während der Chemotherapie hat er die unterschiedlichen Stationen oder Phasen seiner Behandlungen in verblüffend detailreichen, fast an Comics erinnernden Zeichnungen festgehalten. Am stärksten beeindruckt mich ein Portrait, das er von sich selbst gezeichnet hat, als ihm durch die Zellgifte die Haare ausfielen; da hat er sich einfach einen Spiegel genommen, sich mit der Glatze und den Brauen- und Wimpern-losen Augen davor gesetzt und das ganze abgemalt.
Von manchen Mitteln wurde ihm übel, manche verursachten Heißhunger und Gewichtszunahme, und wieder andere Depressionen. Jeder muss da denken, solche Tapferkeit muss doch belohnt werden!
Doch dann ist die Familie in den Skiferien, als die tückische Müdigkeit den Jungen aufs Neue befällt. Das Blutbild zeigt einen Rückfall der Leukämie an; das Knochenmark wirft fast nur noch unreife weiße Blutkörperchen in den Blutkreislauf.
Christian sagt, okay, einmal mache ich noch eine Chemotherapie mit …
Ich wage nicht zu fragen: Und was dann, wenn die Leukämie wieder kommt?
Allmählich kommt auch das Thema „Knochenmark-Transplantation“ ins Gespräch. Ich bin seit 1991 enthusiastische Blutspenderin und interessiere mich für alles, was damit zusammenhängt. Wenn ich Blut spende, bin ich froh, wach und fit; den Beutel mit einem halben Liter Blut schaffe ich jedes Mal, alle zwei Monate, ohne Probleme vollzubekommen. Naiv, wie ich bin, biete ich Gerhard sogar an, falls Christian mal Blut transfundiert bekommen muss, sollten sie doch meines nehmen, das sei wenigstens Aids-frei.
Die zweite Chemo wird durchgezogen, mit den bereits bekannten Nebenwirkungen, nur vielleicht noch schlimmer diesmal. Für alle Fälle wird schon einmal geschaut, ob es einen passenden Knochenmark-Spender gibt. Das ist viel komplizierter als nur wie bei den vier Blutgruppen (ggf. Untergruppen), die zueinander passen müssen, auch ungleich schwieriger als bei normalen Organtransplantationen (Niere, Herz, Lunge etc.), denn eine Vielzahl von Gewebemerkmalen (HLA) müssen zwischen Spender und Empfänger übereinstimmen.
Immerhin ist es erst Anfang der 1990-er Jahre: Eine weltweite Vernetzung der Knochenmarkspender-Dateien mit vielen Millionen spendenwilliger Menschen zur Auswahl gibt es noch nicht. Üblich ist es eher, nur im engen Verwandtschaftsbereich nach HLA-kompatiblen Personen zu suchen; bei vier Geschwistern besteht die Chance, statistisch gesehen, dass eines davon zum Erkrankten passt. Das Problem bei Christian besteht nicht nur darin, dass er als Einzelkind aufwächst – er ist zudem adoptiert, so dass auch seine angenommenen Eltern nicht einmal halbwegs als Spender in Frage kommen.
Christian hat einmal gesagt, wenn er mal sechzehn ist, will er seine leiblichen Eltern mit dem Motorrad besuchen, nicht aus rührseliger Sentimentalität, sondern um selbstbewusst zu zeigen: Hier bin ich, und ich bin wer, schaut her, ich hab’s auch ohne euch geschafft!
Mir kommen die Tränen darüber, wie die Kontaktaufnahme zu seinen leiblichen „Angehörigen“ jetzt stattdessen geschieht, als Bittsteller, erzwungen durch den schlechten Gesundheitszustand. Es stellt sich heraus, dass es eine leibliche Schwester gibt. Sie wird HLA-typisiert; Ergebnis: nicht kompatibel. Eine Typisierungsaktion in dem großen Werk, in dem Gerhards Vater arbeitet, wird geplant, doch dazu kommt es nicht mehr. Im März überstürzen sich die Ereignisse. Wieder einmal stellt sich für mein Bewusstsein der Effekt des „eingefrorenen Bildes“ ein, in gespenstisch-klarer Zeitlupe.
Aus relativ heiterem Himmel ruft mich Herr Meyer in der Firma an: Der Christian ist gestorben, Susanne, kannst du zur Beerdigung kommen?
Ich antworte ihm in falscher Ruhe, wie im Traum, doch als der Hörer wieder auf der Gabel liegt, heule ich durch die ganze Abteilung. Das kann doch nicht sein, gerade lief der Christian noch da herum, fitter als ich, und okay, er war wieder in der Chemo, aber da stirbt man doch nicht so schnell?! In jenen Tagen, vor dem Hintergrund der eigenen, gerade überstandenen ersten Erfahrungen im neurologischen Krankenhaus, brennt unwiderruflich etwas in mir durch.
Erst später erfahre ich, was geschehen ist. Christian starb weder an der Leukämie noch an der Chemotherapie direkt, sondern an einer Blutvergiftung, und zwar deshalb, weil er durch die Vorbehandlung so geschwächt war, vor allem aber, weil der lebensbedrohliche Zustand im Krankenhaus nicht als solcher erkannt worden war. Zudem war es Wochenende gewesen, da ist der Dienst im Krankenhaus auf Sparflamme geschaltet. Der Junge muss starke Schmerzen gehabt haben, doch tapfer wie immer hatte er sie sich nicht deutlich genug anmerken lassen, so dass bei der Ankunft im Krankenhaus wohl eine gute halbe Stunde mit Standardprozeduren wie Personalienaufnahme, Wiegen etc. vergeudet wurde – eine halbe Stunde, die ihm nachher fehlte.
Ich schreie innerlich, das gibt’s doch nicht, da ist er schon im rettenden (?!) Krankenhaus, in der bestens ausgerüsteten Spezial-Uniklinik, bestückt mit der medizinstudierten Abi-Elite, und die lassen diesen Prachtkerl an einer simplen Blutvergiftung sterben!
Flashback: Vertrauen in scheinbare Sicherheit … klatschende, knatternde Rotorblätter …
In mir ist ein Impuls, mich laut schreiend vor den Kopf schlagend wie ein autistisches Kind auf den Boden zu werfen. Stattdessen nehme ich ein Päckchen Rotzfahnen von einer Kollegin an und arbeite weiter.
Am nächsten Tag verabrede ich mich mit Gerhard. Wieso weint er nicht, er kann doch sogar über zertretene Regenwürmer, Schnecken und Kröten traurig sein? Ich will weder zu viel sagen oder fragen, noch will ich gleichgültig-oberflächlich quasseln. Ich bin unsicher, und das sage ich ihm einfach: Ich war unsicher, schon seit der Rückkehr aus Norwegen, wie sollte ich mit eurer Situation mit der Krankheit umgehen, und wie jetzt erst recht mit diesem unersetzlichen Verlust des einzigen Kindes? Jedes Wort von Trauer und Beileidswünschen kommt mir zu viel und hohl vor – keiner kann sich anmaßen zu verstehen, was ihr durchmacht!
Seine Antwort ist wie ein Schlüssel für vieles, was später folgt: „Das ist nun so … die Freunde sind immer mehr fort geblieben …, aber du, Susanne, hast die Sache gut gemacht …“
Am nächsten Tag ist die Beerdigung. Herr Meyer und ich stehen ganz hinten, sehen Anni und Gerhard nur von weitem. Alle aus seiner Schule sind gekommen; es ist überwältigend. Statt Kirchenmusik wird etwas Rockmusik von der CD gespielt, die zuletzt noch in Christians Hifi-Anlage gesteckt hatte. Die Buben von der Feuerwehr tragen den Sarg. Einem von ihnen, Christians Freund, ein kräftiger Kerl, wird schlecht. Später sitzt er am Abend, fast bis Mitternacht, auf dem frisch zugeschütteten Grab.
Kann die Zeit wirklich alle Wunden heilen?
...
© Glaré Verlag
![]() Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
![]()
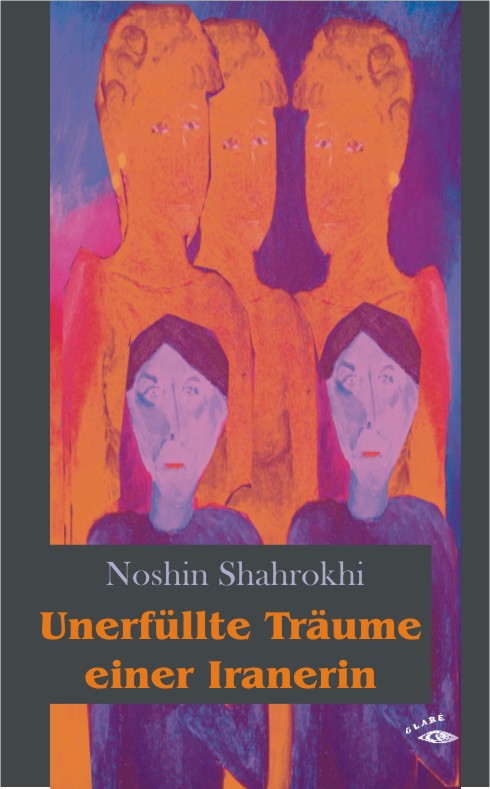 Noshin Shahrokhi
Noshin Shahrokhi
Unerfüllte Träume einer Iranerin
Roman
Der andere Orient 26
186 Seiten. 15,90
Euro
ISBN 978-3-930761-60-9
Auf der LiBeraturpreis-Bücherliste 2009
"Kulturkampf in der Familie" (Neue Presse)
Leseprobe:
Sie öffnete die Balkontür und ihre Hand tastete unwillkürlich nach dem Lichtschalter. Es gab aber keinen. Sie erinnerte sich an den Balkon ihrer Wohnung in Teheran. Dort gab es außen einen kleinen Lichtschalter. In den warmen Nächten glitt ihre Hand wie von selbst über die glatten Fliesen, rosaweiß strahlend wie die Blüten einer Quitte. Wie oft hatte ihr Zeigefinger, ohne dass sie hinsah, den kleinen Lichtschalter nach oben gedrückt.
Hastig zog sie nun ihre Hand zurück. Die Mauer war kalt und rau. Aber dieser kurze Augenblick genügte, um Tausende von Bildern in ihrem Kopf entstehen zu lassen. Eingehend betrachtete sie die graue Mauer ohne Schalter und Licht, um sich zu vergewissern, dass sie nicht träumte.
Sie sah nach oben. Ein dunkler Wolkenschleier verhüllte den Himmel. Seit Jahren hatte sie kein richtiges Blau mehr gesehen. Es war noch Tag, aber der Himmel sah aus, als wollte die Sonne schon untergehen. Auch die Nacht konnte den Himmel nicht in ihr schwarzes Tuch hüllen. Die Nacht versank in einer grauen Aureole, die sich mit ihrem Schwarz verwob. Es glitzerten kaum Sterne darin, es war, als wollten die Sterne nur auf dem schwarzen Tuch des Orients glänzen.
Vorsichtig befreite sie den Spiegel von seiner Verpackung und hängte ihn im Flur ihrer kleinen Wohnung gegenüber der Wanduhr auf. Ihre Hand strich bewundernd über das alte Gehäuse der Uhr. Dann fiel ihr Blick in den Spiegel ihrer Kindheit. Sie schaute sich an und unzählige Bilder wurden lebendig, als hätte der Spiegel sie alle gespeichert. Sie hatte das Buch gelesen, mehrmals sogar, und nun sah sie sich im Spiegel in die Augen, um darin noch einmal die ganze Geschichte zu lesen. Sie sah auch die Wanduhr im Spiegel. Es war genau Mittag.
Die Finsternis senkte sich früher als sonst über den Tag. Der Wind trieb dunkle Wolken über die Stadt und riss die letzten Blätter von den Ästen. Kraftlos, halbtot wirbelten sie gegen ihr Fenster. Eine fürchterliche Bewegung, ein schreckliches Geheul, der Schmerz sprudelte in den Adern der verletzten Blätter, die sich aufgaben und dann doch wieder zum Himmel empor flogen. Die verdorrten Bäume hatten keine Tränen mehr, um die dahinwehenden Blätter des letzten Herbsttages zu gießen. Im Rot des Sonnenuntergangs drehten sich die Blätter im Kreis, sie tanzten traurig und gaben sich der Melodie des Windes hin. Für einen Augenblick begleiteten sie ihn, um dann plötzlich wieder zu sich zu kommen und sich zu krümmen vor Trauer und Wut. In seiner schönsten Blüte versank der Tag in der Finsternis.
Eine Vorahnung erfasste Parastu in ihrem Kummer. Sie mochte keinen Wind. Sie hatte ihn immer gehasst und nun war es, als wollte er sie mit sich nehmen. Ihr schwacher Körper schwankte bei jedem Windstoß und sie versuchte, sich mit jedem Schritt zu widersetzen. Ihr Weg würde noch zwanzig Minuten dauern und der Wind wurde immer stärker. Sie hörte, wie Äste von den Bäumen brachen. Ein frischer Ast fiel von einem uralten Baum herab und landete direkt vor ihren Füßen. Sie kämpfte gegen den Wind an, aber sie kam kaum vorwärts. Würde sie jemals zu Hause ankommen? Parastu war mager und schwach, aber jung. Ihre Mutter war ebenfalls noch jung, aber schon am Ende ihres Weges angelangt. Und wenn das Fenster offen geblieben war und der Wind die Mutter mitgenommen hatte? Sie war nur noch Haut und Knochen.
Die Ärzte wussten nicht mehr zu sagen als: „Kümmern Sie sich um sie, versuchen Sie ihr die letzten Tage so schön wie möglich zu machen.“ Aber wie? Wo Babarahman sie doch verlassen und eine andere geheiratet hatte, eine Frau im Alter seiner Tochter, und sich dessen noch nicht einmal schämte. Wie sollte sie ihrer Mutter die letzten Tage erleichtern, wenn diese ständig erbrechen musste, immer wieder erbrechen, und Schmerzen spürte, solche Schmerzen, und die qualvolle Sehnsucht nach der Zeit, in der ihr Mann sie noch liebte. Der einzige Mann in ihrem kurzen Leben. Der Mann, der einst seine kleine Stadt und alles, was ihn damit verband, aufgegeben hatte, um mit ihr zusammen zu sein. Der Mann, der sie leidenschaftlich vergötterte, der Vater ihrer beiden Kinder.
In jener Zeit schien es, als habe er sich mit dem Leben in der Großstadt abgefunden und sich angepasst, aber nun war er nach Schahrband zurückgekehrt, in jene kleine Stadt, die er in jungen Jahren der Mutter wegen verlassen hatte. Er hatte sich ein Mädchen genommen und war zum dritten Mal Vater geworden. Er lebte sein Leben nun wieder unter Hirten und Bauern auf dem Lande, als wären seine Jahre in der Stadt nicht mehr als ein Traum gewesen, ein Hirngespinst, an das ihn nur noch eine kranke Frau und zwei Kinder erinnerten. Hatte der Krebs wie das Wasser im Fluss alles mit sich gerissen oder wäre die Rückkehr früher oder später ohnehin erfolgt? Die Dinge, die Geschehnisse, auch die, die nicht geschehen sollten, kehrten irgendwann auf natürlichem Wege zu ihrem Ursprung zurück. Das Opfer dieser Rückkehr war die Liebe, die in der Jugend und ihren schönsten Erinnerungen verwurzelt war. Aber nun hatte der Mann alles mitgenommen und in der Einöde ihres Herzens nichts als Rauch und Asche zurückgelassen. Es blieben nur noch zwanzig Minuten und Parastu hatte keine klare Vorstellung vom Tod.
* * * * *
Die Kohle unter dem Korsi war erloschen und die Nacht war kalt. Der Wind hatte nicht nachgelassen und zerrte an den Ästen im Garten des Hauses. Parastu und Farhad hockten jeder in einer Ecke, schweigend in ihre Trauer versunken. Das durch den Tod der Mutter hervorgerufene Gefühl des Verlassenseins warf einen Schatten auf ihre Herzen. Babarahman war nicht gekommen, obwohl er wusste, dass die Tage der Mutter gezählt waren. Er kam nicht und der Schmerz der Kinder wurde immer größer.
„Morgen kümmere ich mich selbst um ihr Leichentuch und die Beerdigung!“, rief Farhad voll bitterer Wut. „Wir werden Babarahman gar nicht erst benachrichtigen. Soll er es doch von anderen Leuten erfahren und sich schämen!“
„Es ist eine Schande. Übermorgen kommen die Trauergäste und fragen, wo der Vater ist“, schluchzte Parastu.
„Nennt man so einen Menschen Vater?“, schrie Farhad. „Sollen es doch alle mitbekommen! Was macht das für einen Unterschied! Babarahman soll sich schämen. Aber das wird er leider nicht tun!“
„Letztendlich fällt es doch auf uns zurück. Und was wird Golpars Familie sagen? Sie suchen doch sowieso nur nach einem Vorwand, um eure Hochzeit zu verhindern.“
Farhad seufzte tief und schüttelte den Kopf. In seinen Adern brodelten Hass und Verzweiflung. Einerseits war da die Überzeugung, die ihn dazu trieb gegen die Ungerechtigkeit anzuschreien, die Überzeugung, die Anlass für Gefangenschaft und Folter war. Andererseits klopfte sein Herz in Gedanken an die Liebe. Er suchte Ruhe und wollte eine Ehe schließen. Entweder hielt er seinen Mund und schwieg oder er verbrachte sein Leben im Gefängnis. Und wer sähe seinen Partner schon gern hinter Gittern? Und wer würde schon ertragen wollen, dass die ganze Familie abgelehnt wird, weil der Ehemann ein politischer Gefangener ist?
Er hatte beteuert, dass er mit der Politik Schluss machen würde, da die Vereinigung mit Golpar wichtiger als alles andere für ihn war. Er hatte Golpars Familie versprochen, sich sämtlicher politischen Aktivitäten zu enthalten, und ihr selbst versichert, dass er von nun an nur noch an sein eigenes Leben denken würde, an sein eigenes Leben mit ihr.
Seine Freunde verhöhnten und verspotteten ihn deswegen, seine Kommilitonen gingen ihm aus dem Weg, als habe er sich verkauft. Sie selbst machten den Mund jedoch nicht auf. Farhad war der erste gewesen, der die verbotenen Worte über die Lippen brachte, und nun sollte er dazu auch stehen und das Feld nicht verlassen. Wer würde das Nichtgesagte aussprechen, wenn auch er schwieg? Die Worte, deren Antwort Gefängnis und Folter waren?
Abfällig sagten sie: „Er mischt sich unter die Hühnerhirten. Er klebt an seinem Leben und hat den Kampf aufgegeben. Oh, er will eine Frau nehmen und denkt nur noch an sich.“
Voller Trauer hörte Farhad die Schmähungen, aber er hielt ihnen nichts entgegen.
„Wieso schweigt ihr, wieso bleiben eure Lippen geschlossen? Wieso dreht sich alles nur um euch und um euer Leben? Warum zieht ihr den Tod nur für euren Freund in Betracht? Wenn ihr etwas zu sagen habt, dann tut es doch! Ihr, die ihr die Lippen zusammenpresst und die Köpfe in tödlichem Schweigen vor den Diktatoren beugt. Bin ich vielleicht euer Sprachrohr?“ All diese Fragen lasteten auf seiner Seele, aber er sprach sie nicht aus. Er wusste, dass er sie niemals aussprechen würde. Er stünde ganz allein, wenn sie jemals über seine Lippen kämen, einsam und ausgestoßen, was ihm weitaus schlimmer erschien als Gefängnis und Folter. Gefängnis und Folter machten aus den politischen Gefangenen Helden, solche Worte aber leiteten den Blick ins Innere, nicht hinauf zum Helden, sondern hinab ins Innere der Person, die nicht in sich hineinschauen wollte, die jedem Infragestellen auswich, die alles tat, um zu vermeiden, dass man auf das verachtenswerte Innere stieß, weil solche Worte einen Schlag gegen den Kopf bedeuteten, der bis zum Herzen widerhallte und das Innere zerkratzte.
Farhad schluchzte auf und schlug mit der Faust gegen die alten, scheinbar festen Wände. Es klang hohl. Seine Schläge hallten in den Wänden wider und an der Decke bildeten sich Risse. Sie bot keinen Schutz mehr, wurde selbst zur Gefahr.
Parastu hatte aufgehört zu weinen. Ungläubig starrte sie auf Farhads Fäuste und auf die Wände, die ebenfalls vom Widerhall Risse bekamen und erbebten. Doch vielleicht kam das Beben nicht von den Fäusten, sondern von den Stiefeln, die in das Haus eindrangen. Das Unglück jener Nacht nahm kein Ende. Gegen Mitternacht tauchten fürchterliche Gestalten auf und nahmen Farhad mit. Die Wassermelone der Yaldanacht zerbarst unter ihren schweren Schlägen und die Geschichten der letzten Herbstnacht trug der Wind mit sich fort.
Diese Nacht fand kein Ende. Die Sonne wollte nicht aufgehen, auf der Erde herrschte tiefste Finsternis. In ihrer Trauer, in ihrer Furcht vor dem Leichnam der Mutter und vor dem, was mit ihrem Bruder geschah, wünschte Parastu sich den Tod. Wenn sie doch die Augen schließen könnte und sie nie mehr öffnen müsste, wenn die Mutter sie nur mitgenommen hätte, wenn sie in der ewigen Umarmung der Mutter Schutz finden könnte, würde sie sterben! Doch sie verabscheute den Tod. Er hatte ihr das Liebste genommen. Da war nur noch der leblose Körper der Mutter, ein Leichnam, von dem sie nicht wusste, was sie mit ihm anstellen sollte. Die Nacht umarmte Parastu mit ihrer schweren Schwärze.
Die Kerzen brannten nieder. Parastu saß neben dem Leichnam. Das Gesicht der Mutter glänzte wie das Mondlicht. Sie lächelte, als sei ihre Seele von den Qualen des Körpers befreit.
Parastu wusste, dass man sie zum Friedhof bringen und an einem fremden Platz begraben würde. Sie war aber untrennbar mit diesem Haus verbunden. Ohne sie würden der Quittenbaum und die tausend Feuerrosen im Frühling nicht blühen. Ihre Seele war mit dem Haus verflochten. Parastu knipste das Licht an und ging unwillkürlich zu Mutters Truhe hin. Sie war voller bunter Stoffe und roch nach Mottenkugeln. Vorsichtig und ohne zu wissen, was sie eigentlich suchte, nahm Parastu die Stoffe aus der Truhe, und ganz unten auf dem Boden des hölzernen Kastens glänzte etwas wie die Sonne. Sie hatte gefunden, was sie suchte, golden schimmernde, leuchtende Seide. Im Badezimmer wusch Parastu die Mutter wie in den Zeiten, als sie noch lebte. Sie massierte ihren Kopf und kämmte ihr kurzes Haar. Ihre grauen Haare waren zu früh gekommen, wie ihr Tod.
Sie schaute Mutters junges Gesicht an, als wäre sie noch am Leben. Die Sonne wollte immer noch nicht aufgehen. Der Wind fuhr in die Äste und Blätter und blies, als wolle er ihr Stöhnen verbreiten, das Stöhnen einer Frau, die mit dem Tod rang, die in Krämpfen lag und deren Schrei sich mit dem Wind verflocht. Ihr Schrei – so nah, so fern.
Parastu nahm die Schaufel und hob unter dem Quittenbaum ein Grab aus. Dann übergab sie die Mutter in goldgelbe Seide gehüllt der Erde.
Eine Träne wischte die Finsternis fort und der Sonnenaufgang raubte ihr die Kraft.
* * * * *
Parastu wäre gern im Haus geblieben. An ihm haftete der Duft der Mutter und es barg tausend Erinnerungen an ihre Kindheit. Doch es war nicht nur das Haus. Sie würde nicht nur das Haus verlieren, sondern auch ihre Freunde und das ganze Viertel, in dem ihr jedes Haus und jede Gasse vertraut war. In jedem Haus kannte sie jemanden und mit den jungen Leuten aus der Nachbarschaft war sie befreundet. Nicht nur das Viertel, die ganze Stadt würde sie verlieren, wenn sie in diesen kleinen Ort zog, wo die meisten Mädchen in ihrem Alter entweder schwanger waren oder bereits Kinder hatten. Sie betrachtete den Quittenbaum, der schon schneebedeckt war. Sie wusste, dass keine Früchte wie die seinen schmeckten, und dass keine Blüte schöner war als die strahlende Blüte des Quittenbaumes.
Dieser Garten, in dem die Mutter die Blumen und der Vater die Bäume gepflanzt hatte. Die Goldfische hatten sie gekauft, als Parastu noch ein Kind war. Damals waren es nur zwei winzige, orangerote Fische, und nun schwammen zweiundfünfzig in dem kleinen Teich.
Dieses Haus mit dem Netz im Keller, in dem sich die Eidechsen verfingen. Wenn Parastu mit anderen Kindern Streit hatte, warf sie mit den Eidechsen nach ihnen und lachte über die entsetzten Schreie. Je lauter die Kinder schrieen, desto mehr lachte Parastu, dann ließ sie die Eidechsen frei.
Dieses Haus, in dem jede Ecke sie an Kinderspiele erinnerte. Die Spiele mit Farhad und Golpar, Siebenstein, Völkerball. Die kindliche Eifersucht, die lange Schatten auf ihre Seele warf, wenn Farhad Golpar mehr Aufmerksamkeit schenkte als ihr oder wenn er lieber Golpar huckepack trug als sie.
„Er wollte doch heiraten, wieso ist er dann in die Politik gegangen?“, fragte Babarahman.
„Er hat nichts getan. Sie haben ihn ohne Grund mitgenommen“, antwortete Parastu monoton, während sie ihre Kleider sorgfältig zusammenfaltete und in den Koffer legte.
„Niemand wird ohne Grund mitgenommen. Sicherlich hat er Mist gebaut. Jetzt kann er Leitungswasser trinken, anstatt eine Frau zu nehmen. Das wird ihm eine Lehre sein!“
„Sie können es nicht sehen, wenn jemand Bücher liest und Verstand hat. Was für ein Verbrechen soll er begangen haben, dass sie ihn verhaftet haben?“
Babarahman zog seine dicken Augenbrauen zusammen. Er war zornig. Mit einer Handbewegung brachte er seine Tochter zum Schweigen. „Du brauchst ihn nicht zu verteidigen. Er hat die Familie entehrt. Er steht doch nicht alleine da! Dich wird jetzt auch keiner mehr heiraten. Allen hat er Kummer gemacht.“
Parastu bekam eine Gänsehaut. Sie fühlte sich scheußlich. Sie hatte das Gefühl, nicht als Mensch, sondern nur als Ware angesehen zu werden. Eine Ware, die auf ihren Käufer wartet. Nun war der Verkäufer in schlechten Ruf geraten und seine Ware blieb unverkäuflich. Wut stieg in ihr auf. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte.
Sie hatte nie richtig mit dem Vater geredet, sondern aus Angst stets ihre Wut heruntergeschluckt und die eigene Meinung für sich behalten. Doch der Tod der Mutter hatte ihre Angst vor dem Vater geschmälert. Eine unwiderstehliche Kraft erfasste sie und ließ die Worte nur so aus ihr heraussprudeln. Parastu wusste nicht mehr, was sie sagte. Sie hatte jegliche Kontrolle über sich verloren. „Farhad soll die Familie entehrt haben? Er ist die Ehre der Familie! Er ist klug und intellektuell. Deswegen wurde er verhaftet. Diese Regierung duldet keine intelligenten Menschen. Er hat in seinem Leben noch keiner Fliege etwas zuleide getan. Aus welchem Grund haben sie ihn eingesperrt? Wem hat er etwas getan? Er brachte die Mutter zum Arzt und kümmerte sich um sie. Und wo warst du? Du hast die Mutter verlassen, du bist nach Schahrband gegangen und hast ein junges Mädchen geheiratet. Auch uns hast du allein gelassen, allein mit der kranken Mutter, die wir pflegen mussten. Bist du nach vier Jahren zurückgekehrt, um uns Vorwürfe zu machen? Bist du jemals gekommen und hast gefragt, wie es uns geht oder ob wir etwas brauchen? Hast du einmal Mutters Hand genommen, wenn sie auf die Toilette wollte? Hast du ein einziges Mal eine Schüssel vor ihren Mund gehalten, wenn sie sich übergeben musste? Und als Farhad schon verhaftet war und ich krank und mit vierzig Grad Fieber kochen musste – wo warst du da? Bist du unser Vater? Wo bist du die ganze Zeit gewesen? Wo warst du, als Mutter starb? Bist du nur gekommen, um Asche auf dein Haupt zu streuen und deine Trauer zu demonstrieren? Nein, wir hatten all diese Jahre keinen Vater, nur eine Mutter, die wir nun auch verloren haben.“
Übermannt von ihren Tränen verbarg Parastu ihr Gesicht in den Händen. Als sie sich ein wenig beruhigt hatte, sah sie, dass auch der Vater seine Hände vors Gesicht geschlagen hatte. Er hockte auf dem Boden und weinte. Voller Verwunderung fiel Parastus Blick auf diesen Mann und dann hatte sie ihr eigenes Bild vor Augen. Der Vater war längst nicht mehr der furchtbare Dämon aus ihrer Kindheit und sie war kein ängstliches Mädchen mehr...
© Glaré Verlag
![]() Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
![]()
Leyla
Auf der Suche nach Freiheit
Roman
Der andere
Orient 21
357 Seiten. 18,00 Euro
ISBN 978-3-930761-40-1
"Freiheit als Schicksalsfrage"
(Entwicklungspolitische Information Nord-Süd)
"Eine anerkennenswerte Botschaft."
(ekz-Informationsdienst)
Leseprobe:
Shirin hielt seine Hände fest. Tränen quollen aus ihren Augen hervor. „Ich kann nichts dafür“, sagte sie mit leiser, bedrückter Stimme, „ich muss halt weinen. Lass mich bitte.“
Er stand schweigend da. Nachdenklich war er. Er wusste nicht, was auf ihn zukommen würde. Er wusste auch nicht, wie er seine Mutter trösten sollte. Nein, er wusste gar nichts. Er zog es vor zu schweigen. Seine Gedanken geisterten wild umher, im Überall und Nirgendwo, es war eine unbekannte und zugleich bekannte Welt. Die Welt der Träume und Ängste. Sein Leben bestand, seit es ihm bewusst war, aus Ängsten und Träumen. Doch je älter er wurde, umso stärker gewannen die Ängste die Oberhand und verdrängten seine Träume. Es machte ihm nicht viel aus, das Leben so wahrzunehmen, es schien ihm sogar sehr authentisch, denn er meinte, der Mensch könne im Grunde nicht anders leben. Zwar distanzierte er sich von den Sprüchen der Frommen, die meinten, der Mensch sei seiner Sünden wegen zu diesem Leben verurteilt. Seiner Auffassung nach war eher das Gegenteil der Fall, es waren die Menschen selbst, die einander zu diesem Leben verurteilten.
Alles hätte anders ausgesehen, wenn sein Vater noch gelebt hätte. Das bildete Kaiwan sich zumindest ein. Schon korrigierte er sich bei diesen Gedanken immer wieder selbst: Dann hätte er wahrscheinlich für ihn Sorge tragen müssen. Und doch wäre seine Anwesenheit für die Mutter auf jeden Fall eine große seelische Unterstützung gewesen. Der Vater wäre finanziell nicht auf ihn angewiesen gewesen, und selbst wenn das der Fall gewesen wäre, so wäre das kein Problem gewesen, denn er hatte Geld genug, ja, sogar mehr als genug.
Wenn er damals nur einen Kern Vernunft besessen hätte, wäre alles anders gekommen. Er sah den Vater vor sich, wie er mit seiner Hartnäckigkeit unbedingt in seinem Alter noch Trecker fahren lernen wollte und schließlich meinte, er hätte es auch gelernt. Tatsächlich konnte er nach ein paar Monaten Selbstquälerei auf dem Feld den Trecker lenken. Wie oft hatte er ihn telefonisch vergeblich davor gewarnt und ihn sogar beinahe flehend gebeten, mit dieser unsäglichen Fahrerei aufzuhören und die Finger von dem Traktor zu lassen. Er könne den Trecker, den er so günstig zum staatlich subventionierten Preis erworben hatte, mit großem Gewinn auf dem freien Markt beziehungsweise Schwarzmarkt weiterverkaufen und das Geld einfach anlegen, darüber hinaus solle er das Feld verpachten, sich zur Ruhe setzen und sich mit Shirin ein schönes Leben machen. Das habe er sich schließlich verdient, es wäre an der Zeit, sich etwas um die Mama zu kümmern, selbst Tante Zari habe ein Recht darauf, in ihrem hohen Alter etwas Angenehmes zu erleben. Er solle mit Mama und ihr auf Reisen gehen, zum Beispiel hätte Tante Zari seit langer Zeit den Wunsch geäußert, die heiligen Städte Mesched und Ghom zu besuchen, von ihm aus könnten sie auch eine Pilgerfahrt nach Mekka unternehmen, er wisse, dass Tante Zari ein Leben lang ohne die geringste Abwechslung gelebt hatte, es wäre sehr, sehr menschlich, wenn er seiner Schwester diesen Gefallen täte. Er wisse, dass er kein frommer Mensch sei, dass er nichts von sämtlichen heiligen Schreinen halte und selbst mit Mekka nichts am Hut habe, aber er solle es als eine schlichte Reise verstehen. Er könne dort die Gelegenheit nutzen, billiger als daheim ausländische Markenwaren einzukaufen, die Angebote der „Duty Free Shops“ nutzen und wie die anderen Pilger auch die Waren zollfrei ins Land schaffen und zu Hause mit beachtlichem Gewinn weiterverkaufen, so würde er, abzüglich der Reisekosten und Verpflegung, sogar noch Gewinne erzielen. Also, wenn ihn das Haus Gottes nicht begeistere, könne er alles als eine Geschäftsreise ansehen. Was habe es für einen Sinn, in der kleinen Stadt zu hocken und sich die kostbare Zeit mit diesem Trecker zu vertreiben. Wenn er finanzielle Defizite habe, so werde er selbst für einen Ausgleich sorgen, denn er verdiene dank Gottes sehr gut und schließlich verdanke er seinem Vater und seiner lieben Mutter vieles, was seinen jetzigen Erfolg im Beruf und im Leben anbelange.
So hatte er versucht ihm zu schmeicheln, auch wenn das nicht seine Art war. Es wäre alles gegangen, wenn der Vater eingelenkt hätte, wenn er nicht so dickköpfig gewesen wäre und auf seine Eigenständigkeit beharrt hätte. Er wäre sogar bereit gewesen, die Mutter und den Vater zu sich nach Teheran zu holen, selbst die alte Tante wäre ihm willkommen gewesen.
Eine Zeitlang, als er in Teheran so allein und traurig war, wünschte er sich das gemeinschaftliche Leben mit Mama und Papa und sehnte sich so sehr nach der Vergangenheit, die er gerne wiederhergestellt hätte. „Warum nicht?“, fragte er sich. Wenn man zu etwas entschlossen sei, könne man es auch durchführen und dazu stehen. Aber die Chancen, den Vater zu bewegen, seine kleine Stadt, insbesondere jetzt sein Feld und den Trecker, zu verlassen und in die Großstadt zu ziehen, waren leider gleich Null.
Der Vater war sein ganzes Leben lang so gewesen, er hatte getan, was er für richtig hielt, wenn er auch häufig im Unrecht war. Das wusste jeder in der Stadt. Nun schien er tatsächlich am Treckerfahren Gefallen gefunden zu haben. Er fuhr gerne in den wenigen Straßen seiner Stadt. Häufig nahm er auch Kinder beziehungsweise Jugendliche mit und fuhr sie von einem Ende der Stadt zum anderen. Die Jungen hatten nichts zu tun, sie amüsierten sich dabei, mit dem Trecker durch die Straßen zu fahren, genauso wie Kaiwans Vater, der den Trecker nicht mehr als eine Woche im Jahr für die Arbeit gebrauchen konnte, und das auch nur, wenn man die Zeit für das Pflügen, für die Ernte und alles drum und dran zusammenzählte. Es war Kaiwan höchst peinlich, als er hörte, dass sein Vater diese jungen Menschen durch die Stadt kutschierte, sich sinnloserweise den Jugendlichen als kostenloses Taxi zur Verfügung stellte. Die Jungen nutzten ihr Gefährt natürlich auch gerne dazu, um bei den Mädchen Eindruck zu schinden. Wenn gerade ein Mädchen vorbeihuschte, riefen sie ihm laut hinterher und winkten heftig. Lustiger war es, wenn sie an einer Gruppe von Mädchen vorbeifuhren, dann war die Mädchengruppe im Gegensatz zu einzelnen Mädchen, die schüchtern ihr Gesicht abwandten, keck, sie winkten zurück und manche riefen ihnen sogar etwas nach. Dann wurden die Passanten noch aufmerksamer, manche schüttelten sogar verächtlich den Kopf.
Das alles störte Kaiwans Vater nicht, im Gegenteil, er gewöhnte sich ebenso wie die Jugendlichen daran. Manches Mal, wenn er etwas zu tun hatte und nicht rechtzeitig mit seinem Trecker auftauchte, kamen einige der Jugendlichen, die in der Nähe wohnten, zu ihm und erkundigten sich nach ihm, indem sie von der Gasse aus riefen: „Hey, Onkel Firuz, wo steckst du?“ Ob er krank sei oder nicht etwa der Trecker kaputt wäre? „Gott möge dich und deinen Trecker für immer und ewig am Leben erhalten!“, hieß es dann.
Dies alles störte Kaiwan sehr und er meinte, sein Vater benehme sich wie ein Kind, höchstens wie ein Jugendlicher, der den Trecker als Spielzeug betrachte. Irgendwie lag Kaiwan damit nicht ganz falsch. Der Vater war immer kindisch gewesen, schon damals, als seine Kinder noch klein waren, kaufte er ihnen gern Aufzieh-Autos, mit denen er dann selbst als erster spielte. Aber nun war sein Spielzeug wirklich gefährlich und schon gar kein Spielzeug. Kaiwan hatte sich einmal aufgeregt und ins Telefon gebrüllt: „Schau mal, wenn du einmal umkippst, kostet das einige dieser jungen Leute das Leben!“
...
Der Vater war vor zwei Jahren tödlich verunglückt. Er konnte diesen Tag, an dem er die Nachricht vom Tod seines Vaters erhalten hatte, nicht vergessen. Es war ein merkwürdiger Tag gewesen, dieser Tag hätte sein Leben auf eine andere Bahn leiten können. Am Vorabend jenes Tages war er, als er seine Praxis verließ, dermaßen fröhlich gestimmt, dass er ein Lied pfiff und sogar vor sich hin summte: „Leyla, Leyla, Leyla, du bist meine Freundin, Leyla. Leyla, Leyla, du bist mein Leben, Leyla.“
Seit Jahren hatte er sich nicht mehr so ausgelassen gefühlt. Sein Beruf als Arzt machte ihn auf zweierlei Weise unglücklich, einerseits musste er sich autoritär geben und so dem gesellschaftlichen Verlangen nachkommen, andererseits war die tägliche Begegnung mit den vielen kranken, vor allem armen Menschen für ihn kein Zuckerschlecken, er war ein sensibler Mensch und die Sensibilität hatte er von seiner Mama geerbt. Harte Urteile über die Menschen zu fällen, das hatte er von seinem Papa geerbt. Diese beiden Eigenschaften nutzten ihm und zugleich schadeten sie ihm.
Er arbeitete Vollzeit in einem Krankenhaus und drei Tage beziehungsweise Nachmittage bis zum späten Abend in einer Praxis, die seinem älteren Kollegen gehörte. An jenem Tag nun war alles ganz anders, er hatte quasi Urlaub, was die Arbeit im Krankenhaus anbetraf. Dafür arbeitete er nur ein paar Tage die ganze Zeit freiwillig in der Praxis, und das auch nur ausnahmsweise, denn sonst war er immer im Urlaub weggefahren, häufig zu seinen Eltern. Er war heute sehr aufgeregt und etwas ängstlich. Zum ersten Mal holte er eine Frau von ihrer Arbeit ab, sie waren vor einer schicken Pizzeria in einem nördlichen Teheraner Stadtteil verabredet, zwei Straßen entfernt von dem Ministerium, in dem sie arbeitete.
Er hatte kaum fünf Minuten am Straßenrand gewartet, da tauchte Leyla auf, unbeschreiblich zurechtgemacht, mit einer kleinen Reisetasche in der Hand. Sie hatte sich zuvor im Vorraum der Toilette der Pizzeria nicht nur reichlich geschminkt und ihr Haar beziehungsweise die Teile ihres Haars, die sie zeigen durfte, geschmackvoll frisiert, sondern sich auch umgekleidet. Es war eine abgemachte Sache zwischen dem Pizzeriabesitzer und den jungen Frauen, die sich von den erbärmlichen Kleidungsvorschriften an ihren Arbeitsplätzen befreien wollten, es war ein Stück Entgegenkommen gegenüber den Frauen, die wie Leyla direkt nach der Arbeit ein Rendezvous hatten, und zugleich eine gute Werbung, die die Pizzeria für junge Leute attraktiv machte. Die Frauen kamen in ihrer Arbeitskleidung in die Pizzeria, wo sie sich in der Toilette umzogen und sorgfältig schminkten. Leyla war nun zwar vom Scheitel bis zur Sohle schwarz gekleidet, aber nicht mehr mit diesem unförmigen schwarzen Mantel und dem groben Kopftuch, diese obligatorischen Scheußlichkeiten hatte sie in die Reisetasche gequetscht. Ihre glänzenden schwarzen Pumps, die fein ihre in transparenten schwarzen Strümpfen steckenden Füße umhüllten, waren haargenau auf die hautenge glatte, einer Krokodilhaut ähnelnde Hose abgestimmt, deren schwarzer Stoff gerade mal bis zum Knöchel reichte. Als Oberteil trug sie einen schwarzen Seidenkasack, der eher wie ein Sakko aussah, als dem obligatorischen sackartigen Mantel für Frauen zu ähneln. Ihr Kopftuch war nichts anderes als ein schwarzer Hauch aus Seide, locker über ihr Haar geworfen, wobei man ihre riesigen schwarzen Ohrringe, die wohl abgestimmt auf die Armbanduhr und die Steine ihrer drei Fingerringe waren, wunderbar sehen konnte. Ihre von einem ewigen einladenden Lächeln gezeichneten vollen Lippen trugen die Spuren eines leichten dunklen Lippenstifts. Denn sie hatte in den vielen Telefongesprächen mit Kaiwan herausfinden können, dass er stark geschminkte Frauen nicht besonders mochte. Wie sie darunter angezogen war, erfuhr man vor der Pizzeria nicht, doch konnte man es bereits erahnen. So stolzierte sie wie ein wildes, dennoch gezähmtes Reh auf Kaiwans Auto zu.
Leyla öffnete die Hintertür des Autos, sie warf ihre Kleidertasche auf den Rücksitz und knallte die Tür wieder zu. Dann öffnete sie die Beifahrertür und stieg ein. „Salam“, sagte sie.
„Salam“, antwortete er. Sie berührten auf der Höhe der Autositze ihre Hände so, dass man es von außen nicht sah, und drückten sie herzlich. Sich mehr als diese bescheidene Geste zu erlauben, war an öffentlichen Orten des islamischen Gottesstaates höchst riskant. Entsprechend ihrer Vereinbarung fuhren sie in die Berge im Norden Teherans. Es war immer noch ganz hell. Sie stellten das Auto ab und liefen zuerst ein Stückchen an den schönen Restaurants vorbei. Sie hatten das Glück auf ihrer Seite, denn zu dieser Uhrzeit mitten in der Woche war keine Menschenseele unterwegs. Sonst war dort die Hölle los, insbesondere an den Wochenenden machten sich Scharen junger Menschen auf den Weg ins Gebirge, wo sie im Rahmen dieser in den Bergen verborgenen, nicht ganz risikolos zu genießenden Freiheit etwas flirten und einander näher kommen konnten. Es war schon ein wenig unheimlich, denn die Angst vor den islamistischen Sittenwächtern war da, wenn auch nicht allzu groß, insbesondere in den Köpfen der nicht mehr ganz Jungen wie Kaiwan und Leyla. Vielleicht steigerte das die Spannung beim Austausch von Liebesbeweisen und ihrer leichten Körperberührung.
Sie vermochten nicht weit zu gehen, doch waren die menschenleeren Gebirgszüge bezaubernd und dämonisch zugleich. Zwischen einigen Felsbrocken blieben sie stehen. Sie schauten sich um, die Luft war herrlich, die paradiesische Ruhe zwischen den Bergmassen, den Felsen, konnte man mit jeder Faser des Körpers spüren. Sie polierte die Seele und weckte die tiefste und schönste menschliche Begierde. Niemand konnte sie sehen, es war auch weit und breit niemand da. Um auf Nummer sicher zu gehen, stieg Kaiwan auf einen der Felsen und schaute sich sehr genau um, so weit seine Blicke reichten, spähte er in die Ferne, in der man nur Gottes Macht spürte und die Ruhe der gewaltigen Natur. Keine Spur von den selbst ernannten Gottesmännern! Nein, tatsächlich war weit und breit keine Menschenseele zu entdecken. Er sprang wieder herunter. Sie rückten näher zueinander. Leyla kuschelte sich an Kaiwan. Er genoss den Duft ihrer Haarmassen, die nun über ihre Schultern und einige Strähnen auch über ihr Gesicht flossen, denn sie waren in diesem herrlichen Augenblick ganz frei und die leichte abendliche Brise strich sanft über sie hinweg. Das verdammte Kopftuch hatte sie in die Tasche gesteckt.
„Wie schön wäre es, wenn man immer so frei sein könnte“, seufzte Leyla.
„Ja, wenn“, klagte Kaiwan. „Unser Leben ist von tausenden solcher ’wenns’ eingeschränkt.“
Er schaute in ihre Augen, die vor ihm blinzelten, als ob sie einen Weg zum Leben suchten, einen Weg, der anders sein sollte als alle anderen Wege. So jedenfalls wirkte es auf Kaiwan. Er näherte seine Lippen ihrem Mund und küsste sie sehr vorsichtig, als wären ihre Lippen gerade aus weichem Wachs geformt und er wollte keine Beule hineindrücken. Ihre Atemzüge vermischten sich in einem innigen Moment. Sie hatten beide nicht die Absicht gehabt heftiger zu werden und es war auch nicht der Ort, an dem man den inneren Trieben völlig freien Lauf ließ. Darüber hinaus war es schon erlösend, sich in dieser Freiheit gegenseitig anzuschauen, einander die Gefühle, die über die körperliche Berührung hinausgingen, zu signalisieren. Sie schnupperten aneinander unter dem wolkenlosen Himmel des Gottesstaates, in dem die falschen Gottesmänner das Leben der Menschen zur Hölle zu machen gedachten. „Warum gönnen sie den Menschen keine Behaglichkeit?“, beklagte sich das Liebespaar. Es war eine andauernde, wohl berechtigte Anklage der Menschen in diesem Land. Nein, sie wollten diesen kostbaren Moment nicht mit Gedanken an diese und jene Unannehmlichkeit vergeuden. Darum summte Kaiwan in Leylas Ohr: „Leyla, Leyla, Leyla, du bist mein Leben, Leyla.“ Sie lächelte und klammerte sich fester an ihn, fuhr mit der Nase schnuppernd über seine Wangen, fühlte seine Atemzüge: „Leyla, Leyla, Leyla, du bist meine Leyla“, summte er weiter.
„Du bist auch mein“, sagte Leyla voller Charme.
Sie lachten und strichen wieder ihre Lippen aneinander, so breitete sich eine Woge der merkwürdigsten Gefühle in ihren Körpern aus und versetzte sie in eine Art Schwerelosigkeit. Sie hatten das Gefühl, als beabsichtige die stürmische Karawane der Liebe, sich in ihnen niederzulassen. Die Sonne war dabei, sich hinter den Bergen zu verstecken. Es hätte noch schöner werden können, wenn es weiter so geblieben wäre. „Wollen wir wieder nach unten zurückkehren, bevor es dunkelt?“, fragte Kaiwan.
„Ja“, erwiderte Leyla, „kehren wir lieber zurück.“
Im Gottesstaat musste man sich zu jeder Zeit und an jedem Ort im Griff haben. Der freie Lauf der menschlichen Gefühle konnte gefährlich werden, denn die falschen Gottesmänner hatten weder für die Menschen noch für die den Menschen von Gott gegebenen Schönheiten Verständnis.
Arm in Arm liefen sie sehr langsam in Richtung der Restaurants zurück. Bevor das erste Haus zum Vorschein kam, warf Leyla wieder das teuflische schwarze Tuch über den Kopf, dabei überkam sie das Gefühl, als hätten unsichtbare Hände ihr Handschellen angelegt. Sie liefen nun nicht mehr Hand in Hand und Arm in Arm, sondern mit ein wenig Abstand nebeneinander her. Sie wählten ein Restaurant und aßen sich gemütlich satt. Es war ganz dunkel, als sie sich auf den Weg zum Auto machten. „Essen und Scheißen könnte man gut in unserer so genannten heiligen Republik, wenn man genug Geld hätte“, pflegten die Leute zu sagen, die mehr als die Befriedigung der Gedärme verlangten. Kaiwan wollte wissen, ob er Leyla nach Hause fahren solle, beziehungsweise bis in die Nähe ihres Hauses. „Weder noch“, sagte Leyla lächelnd. „Ich komme zu dir, wenn es dir recht ist.“
Kaiwan fühlte sich wie überfallen. Erst sagte er unbeholfen: „Natürlich geht es.“ Dann fügte er etwas später hinzu, als ob es ihm gerade eingefallen wäre: „Was sagst du deinen Eltern?“
Leyla lächelte wie eine erwachsene Frau. Sie war auch erwachsen, Mitte zwanzig. „Ich bleibe öfters über Nacht bei meinen Freundinnen. Ich habe heute zu Hause gesagt, dass ich abends nicht nach Hause komme.“
Kaiwan war es recht, er hätte vor Freude beinahe die Kontrolle über sich verloren und sie um ein Haar auf der Straße umarmt. Es war aber nur ein kurzer Moment, sofort war ihm wieder klar, wo er sich befand. Dabei schien Kaiwan ein wenig hinter der Zeit geblieben zu sein. Er wusste nicht, dass solcherart Verabredung mittlerweile gang und gäbe war. Einen braven Jungen hatte man ihn genannt, fleißig und immer konzentriert auf seine Arbeit. Und das war er. Man sah es an den erzielten Ergebnissen. Es gelang nur noch wenigen in seinem Alter, eine solche Karriere zu machen.
Als sie in der Straße ankamen, wo er sogar ein eigenes Haus, wenn auch nicht sehr groß, hatte, schlug Leyla vor, zweihundert Meter entfernt auszusteigen. Sie käme dann allein hinterher, damit die Nachbarn nicht mitbekommen würden, dass er eine junge Frau mit sich nach Hause nahm. Er betonte, diese Umstände seien nicht nötig, denn in dieser Gegend seien die Nachbarn nicht neugierig, schon gar nicht auf die Besucher der anderen. Überdies könnten sie direkt in den Hof hineinfahren, an diesem dunklen Abend werde, selbst falls jemand neugierig wäre und hinschaue, niemand sehen können, wer im Auto sitze. Er hätte beinahe gesagt, dass er schon öfters mit Frauen so nach Hause gekommen war, doch das war nicht angebracht, denn die Frauen, die er gelegentlich mit nach Hause nahm, waren Straßennutten oder einfach Frauen, die sich einen Seitensprung leisteten. Sie fuhren also zusammen bis zum Haus.
Schön war es bei ihm. Leyla legte ab und ihre wahre Schönheit kam zum Vorschein, märchenhaft, wie gemalt. Selbst die modisch geschnittenen Kittel erfüllten noch ihren Zweck, solch eine Schönheit zu entstellen. Kaiwan hieß sie willkommen, indem er sie herzlich umarmte. Dann sorgte er für Musik. In einer verborgenen Kammer hatte er allerlei Getränke, Whiskey, Wodka, Bier, Wein usw., denn er konnte sich dieses und jenes auf dem Schwarzmarkt leisten. Leyla bevorzugte Whiskey. Er füllte zwei Gläser und gab Eis dazu. Schon war ein Tisch mit frischen Limonen, Chips, einer Schale mit verschiedenen Nusssorten, einem Korb Obst geschmackvoll arrangiert. In der Zwischenzeit hatte Leyla sich erfrischt und kam nun mit offenem, wildem Haar, noch schöner als vor zehn Minuten, aus dem Bad, denn man konnte nun den Anblick ihres wohlgeformten Körpers in Hose und Bluse genießen. Kaiwan war immer noch im Anzug. Er verschwand im Schlafzimmer, um Hauskleider anzuziehen.
Die Musik tönte vor sich hin. Es war iranische klassische Musik. Leyla hätte gern eine andere Musik gehört, ein milder englischer Song hätte besser zu diesem Abend gepasst. Aber mit der klassischen Musik konnte man auch auskommen, man musste sich nicht in ihre traurigen hohen und tiefen Melodien hineinsteigern, man konnte sie einfach an sich vorbeiklingen oder sich von den romantischen Stellen inspirieren lassen und sich trotzdem als konkrete Menschen mit konkreten Bedürfnissen wahrnehmen. Das hatte sie auch vor. Kaiwan hatte keine anderen CDs. Er war nun auch da. Sie stießen auf das Wohl des Abends an. Es war merkwürdig, dass sie heute Abend im Gegensatz zu sonst so wenig miteinander sprachen. Insbesondere Kaiwan war ungewöhnlich still, sonst war er ein Laberkopf, wie Leyla meinte, stundenlang konnte er unermüdlich über Gott und die Welt reden.
In dieser Nacht blieben sie lange wach. Sie liebten sich wieder und wieder. Er war das erste Mal, dass Kaiwan mit einer unverheirateten Frau schlief, an diesem Abend wurde ihm bewusst, dass sich die Zeiten doch schleichend geändert hatten. Es machte ihm nichts aus, im Gegenteil bereitete es ihm Freude, Freude darüber, mit einer ungezierten Freundin, die wusste, was sie wollte, eine wundervolle Nacht zu verbringen. Eine schöne Veränderung, dachte er bei sich. Er erlaubte sich nicht, Leyla zu fragen, was mit ihrer Jungfräulichkeit sei. Als Arzt hatte er schon davon gehört, dass junge Frauen, wenn es darauf ankam, bei der Heirat die Jungfräulichkeit nachzuweisen, diese durch einen Chirurgen wiederherstellen ließen, allerdings hatte er sich bislang nicht um solches Gerede gekümmert, da er es für Gerüchte hielt. Leyla aber gehörte anscheinend zu den Frauen, die das absurde Kapitel des Jungfernhäutchens für sich beendet hatten. „Mutig, mutig“, wiederholte er in sich hinein. Genau das machte Leyla für ihn noch interessanter.
...
Unausgeschlafen und mit schwarzen Augenringen saß er in seinem Auto in der Nähe der Imam-Hossein-Moschee, vor der Hausnummer, die Leyla ihm genannt hatte, und schaute sich um, soweit er das aus dem Auto heraus konnte. Er erwartete ungeduldig seine Leyla. Er hatte es vollkommen aufgegeben, sich über den Sinn und Zweck dieses frühen Rendezvous den Kopf zu zerbrechen. Eines war ihm nur wichtig, Leyla wieder zu sehen. Soweit er feststellen konnte, war weit und breit keine Spur von Leyla. Um diese Uhrzeit waren viele Menschen unterwegs, zur Arbeit, zu Behörendengängen, zum Einkaufen, Leute aus der Provinz, die früh angekommen waren … Nicht, dass Leyla ihn einfach auf den Arm nehmen wollte, ging es ihm durch den Kopf. War das gestern Abend überhaupt Leyla am Telefon gewesen, fragte er sich kurz.
Da näherte sich eine Frau, eingehüllt in einen hässlichen, dicken schwarzen Schleier, seinem Auto. Er schaute weg, in die andere Richtung. Er hasste solche Frauen, die sich so übertrieben verhüllten, von so einer wollte er sich an diesem frühen Morgen nicht die Laune verderben lassen. Er legte seine Stirn an das Lenkrad und schloss die Augen, um die Frau auch von hinten nicht sehen zu müssen, wenn sie vorbeitrampelte.
Aber die Frau öffnete die Beifahrertür und schlüpfte auf den Beifahrersitz. „Salam“, sagte sie.
Kaiwan hob den Kopf und sah mit einem Mal aus wie vom Schlag getroffen.
„Leyla?“, rutschte es ihm über die Lippen. „Um Gottes willen!“
Leyla brachte ihr Gesicht etwas zum Vorschein. Ihr schönes Gesicht. Und fast weinend sagte sie: „Ja!“
Kaiwan war nun völlig sprachlos. Er konnte nicht glauben, dass Leyla so mit ihm scherzte. Diese Art von Scherz fand er geschmacklos. Er hätte beinahe geschrieen: „Was soll dieser Unsinn?!“ So lange hat sie sich versteckt und nun kommt sie so, ging es ihm durch den Kopf. Der gesamte Innenraum des Autos schien finster, nur Leylas Gesicht leuchtete wie der Vollmond in einer stockfinsteren Nacht.
Leyla merkte, dass sie Kaiwan einen Schock versetzt hatte. Um ihn aus dieser Verwirrtheit herauszuholen, sagte sie: „Ich erzähle dir alles, wundere dich nicht. Ich bin nicht verrückt geworden. Nun fahr bitte los.“
„Wohin?“, brachte Kaiwan hervor, immer noch ganz durcheinander.
„Irgendwohin, wo wenige Menschen sind, am besten gar kein Mensch zu sehen ist.“
Kaiwan fuhr einfach los, er steuerte geradeaus und wusste nicht, wo es einen Ort mit wenigen Menschen in dieser mit Menschen voll gestopften Stadt gab. Irgendwie hatte er Angst weiterzufragen, wie es ihr ergangen sei und warum sie so auftauche. Er ahnte nichts Gutes. Zumal Leyla verstört und hilflos auf ihn wirkte. Das war nicht seine Leyla, diese verstümmelte Frau, die alle Gram und Pein dieses Landes in sich konzentrierte, das konnte nicht seine Leyla sein. Sie wollte die stolze Leyla ächten, sie an den Galgen bringen. Sie wollte ihm Leylas Ende erklären. Nein, das war nicht die Leyla, die entzückende, charmante und von Liebe ergriffene, offenherzige Frau, unter deren Schritten die Erde bebte.
„Leyla, Leyla, Leyla, du bist mein Leben, Leyla“, summte er in sich hinein. „Leyla, Leyla, Leyla, du bist meine geliebte Leyla, oh, Leyla, sie stahlen mir Leyla, meine schöne Leyla …“
Leyla brach das bedrückende Schweigen, das schwer wie Blei in der Luft lag: „Du musst mir helfen.“ Und wieder schwieg sie. Als habe sie das Sprechen verlernt und könne nur diesen Satz hervorbringen.
Kaiwan nahm sich zusammen und sagte: „Das hast du am Telefon auch gesagt. Sag mal, was ist mit dir passiert?“
Die ganze Zeit über hatte Leyla einen Kloß im Hals gespürt. Plötzlich schluchzte sie auf, Tränen sprudelten und rollten in alle Himmelrichtung über ihr merklich blasses Gesicht. Kaiwan wurde nervös. Er schaute nach einer Möglichkeit, um am Straßenrand zu halten, ihr etwas zu trinken zu holen. Aber Leyla bedeutete ihm mit Gesten, weiterzufahren. Sie fuhren weiter geradeaus auf dieser unendlichen Hauptstraße in Richtung Osten. Zu dieser frühen Stunde war im Gottesstaat kein Ort, an den man mit einer Frau hineingehen konnte. Wäre es Mittag gewesen, hätten sie irgendwo essen gehen können.
„Sie haben mich die ganze Zeit eingesperrt und mir das Telefon weggenommen, bis ich zugestimmt habe“, brachte Leyla schluchzend hervor. „Ich darf nur unter dem Vorwand des Gebets das Haus verlassen, und das verdanke ich auch meiner Mutter, die sich bei ihnen durchsetzen konnte.“
Leyla weinte und schniefte weiter, sie konnte nicht mehr reden. Kaiwan war immer noch erstaunt, er verstand überhaupt nicht, wovon sie redete. Er fragte nur, ob man ihr seinetwegen verboten habe, das Haus zu verlassen. Als Leyla das verneinte, war er erleichtert. Er wusste, dass Leylas Eltern von ihrer Beziehung zu ihm nichts wussten. Aber er konnte sich nicht erklären, warum ausgerechnet in dieser Woche, in der er nicht in der Stadt gewesen war, etwas so Schockierendes hätte passieren sollen. Seine Gedanken drifteten weiter, sie umkreisten die Orte, an denen den Menschen zumindest die einfachsten Dinge vergönnt waren. An einem Ort, an dem so sensible und liebenswürdige Wesen wie Leyla nicht so gequält und nicht zerstückelt wurden. Seine Gedanken waren dort, wo Gott die falschen, selbst ernannten Gottesmänner zur Rechenschaft zog, wegen Verrats an der menschlichen Würde und dem Quälen seiner Geschöpfe in seinem Namen und somit dem Beflecken des Namen des Herrn. An diese Orte schwebten seine Gedanken. Er schämte sich vom Geschlecht Adams und Evas zu sein. Er summte in sich hinein: „Leyla, Leyla, Leyla, du bist mein Leben, Leyla. Leyla haben sie umgebracht, du bist meine Liebe, Leyla.“ Seine Gedanken suchten sie dort, wo Leyla lebte, blühte und lachte und wie gemalt neben ihm lag und ihn aufforderte, sich zu ihr zu legen, wo ungestört ihre Körper und ihr Geist verschmolzen. Dort konnte er Gott dankbar sein, dass er so eine Leyla erschaffen hatte. Hier war er nur zornig darüber, was man aus seiner Leyla gemacht hatte.
Inzwischen hatte sich Leyla ausgeweint und sie beruhigte sich wieder. Sie erzählte, dass ihr Vater infolge einer Vereinbarung, laut der ihr Bruder eine höhere Position in irgendeinem Amt bekommen würde, ihre Heirat mit einem abscheulichen Kerl, den sie überhaupt nicht kenne, versprochen habe. Seit Monaten habe er versucht, sie dazu zu bringen, ihre Zustimmung zu dieser Heirat zu geben. „Zuerst haben sie es auf die sanfte Tour probiert, dann, als sie merkten, dass sie keinen Erfolg hatten, haben sie mich eingesperrt. Er meinte, es sei eine gute Sache, sowohl für mich als ziemlich altes Mädchen, immer noch ohne Mann, das nun heiraten könne, als auch für meinen Bruder, der durch diese Heirat befördert wird. Besser könne man es nicht treffen.“ Ihr sei keine Wahl geblieben. Sie müsse ihn nun heiraten und das Beste daraus machen.
Leyla schwieg. Sie war innerlich entsetzt, wenn sie alles in ihrem Kopf Revue passieren ließ, konnte sie nicht verstehen, wie der liebe Papa sich gegenüber seiner einzigen Tochter so etwas erlauben konnte. War er wirklich in Panik geraten, hatte er aus Not und Verzweiflung wegen der Zukunft seiner Kinder so gehandelt? Das konnte es nicht sein, denn sie waren reich und hatten genug.
„Nein, nein“, murmelte sie vor sich hin. Sie wusste aber, dass der Vater seine Meinung vielmals in dieser extremen Weise geändert hatte, sich quasi angepasst hatte, um vor Schlimmerem verschont zu bleiben, das hatte sie nie verstanden und es gab für sie auch keinen Grund, den Versuch zu unternehmen, es zu verstehen.
Kaiwan fuhr weiter geradeaus. Er war irgendwie fassungslos und wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Die Sache schien für ihn gelaufen zu sein, Leyla konnte entweder wie andere Frauen abhauen und sich in ein ungewisses, ohnehin höchst gefährliches Schicksal begeben, oder dem Willen ihres Vaters nachgeben. Wie sie das Beste daraus machen wollte und was sie damit meinte, blieb ihm rätselhaft und er vermochte nicht danach zu fragen. Wenn Leyla sich ohne Zustimmung ihres Vaters für eine Heirat hätte entscheiden können oder dürfen, hätte er sie sofort geheiratet. Er wusste genauso wie sie, dass Leyla, wenn sie ihrem Vater von ihrer Beziehung zu ihm erzählt hätte, das Ganze noch schlimmer gemacht hätte. „Ich bin daran schuld, ich Trottel“, sagte Kaiwan plötzlich.
„Wie kommst du denn darauf?“, fragte Leyla verwundert.
„Ich hätte früher daran denken sollen, dich zu heiraten. Ich hätte vor diesem Typ zu deinem Vater gehen und um deine Hand anhalten sollen. Ich weiß es, ich hätte die Initiative ergreifen müssen. Es tut mir so Leid, Leyla.“
„Nein, Kaiwan, nein, du Lieber, diese Geschichte ist älter als unsere Freundschaft, damit hast du nichts zu tun. Du konntest nichts machen, sonst hätte ich dir etwas gesagt. Denn seit über einem Jahr flüstert mir mein Vater ins Ohr, er hätte einen Bräutigam für mich. Aber ich hatte die Hoffnung, dass es sich von selbst erledigen würde. Ich habe die Geschichte nicht so ernst genommen, ich habe die ganze Zeit gehofft, dass sich für diesen so genannten Bräutigam eine andere Frau findet. Aber es scheint, dass er ein unfähiger Typ ist.“
Kaiwan grübelte nach, wie er ihr helfen könnte. Vielleicht wollte Leyla ins Ausland abhauen, das wäre eine Möglichkeit, die jedoch auch nicht kurzfristig möglich war, darüber hinaus steckte sie voller Gefahren. Denn Leyla könnte das Land nur auf illegalem Wege verlassen. Ihr in einer anderen Stadt in Iran eine Wohnung zu mieten, bedeutete ein Leben in Versteck und Illegalität, falls die neugierigen Augen der Nachbarn sie in Ruhe ließen und sie nicht verrieten, was kaum vorstellbar war. Es war glasklar, wenn eine junge Frau ohne Arbeit ohne Grund in einer fremden Stadt, groß oder klein, hauste, war das auch ohne Weiteres höchst verdächtig. Während Kaiwans Gedanken zwischen diesen und jenen Lösungsmöglichkeiten hin und her sprangen, sagte Leyla plötzlich: „Du musst mir helfen!“
Ihr Gesicht war rot angelaufen, Kaiwan konnte sie nicht richtig sehen. Sie rieb nervös ihre Hände und fühlte sich in einer ungeheuren Zaghaftigkeit ausgeliefert. Zugleich machte sie sich immer wieder von neuem bewusst, dass sie vernünftig handeln musste. Mit bebender Stimme wiederholte sie: „Ich schäme mich, ich schäme mich, ich schäme mich. Ach, wäre ich nur tot.“
Kaiwan unterbrach sie: „Du brauchst dich nicht vor mir zu schämen, wir sind Freunde und Vertraute. Sag doch ruhig, was ich tun kann.“
Ihm ging zugleich durch den Kopf, höchstens verlangt sie von mir, dass ich sie verstecke. Aber wie lange und wo? Er würde sich etwas einfallen lassen, selbst wenn es darauf ankäme, seinen Beruf und seinen Ruf aufs Spiel zu setzen, er würde sie nicht im Stich lassen. „Leyla, Leyla, Leyla, du meine Leyla, ich bin auch deins, Leyla“, sang er laut und lächelte sie ermutigend an.
Aus Leylas Augen sprudelten Tränen. Er hoffte Leyla zu beruhigen und ihre Fassung und seine eigene wieder in Ordnung bringen zu können. Er fuhr und fuhr. Sie waren inzwischen außerhalb der Stadt beziehungsweise in einem der östlichen Vororte der Megastadt. Er kannte sich sehr gut mit diesen Ortschaften aus. Hierher fuhr er häufig allein, dann parkte er in den Bergen, wo es ruhig war, und versank stundenlang in Gedanken, manches Mal nahm er auch seine Querflöte mit, das einzige Instrument, das er spielen konnte, und spielte traurige Weisen für sich und das einsame Gebirge. Hin und wieder sah er glückliche Paare, die dort eine Zuflucht suchten, um fern von den Augen des Gottesstaats Zärtlichkeiten auszutauschen, auch wenn es selbst dort nicht ganz risikofrei war, denn die Sittenwächter kannten diese kuscheligen Orte und ahnten von den Treffen den Liebenden, die in ihren Augen Sittenbrecher waren, an diesen Orten, so bestand die Gefahr, dass sie dort ab und zu mit ihren Nissan Patrols patrouillierten. Nun war er zufällig und unbewusst in dieser Gegend gelandet. Er verließ die Hauptstraße und bog in eine schmale Schotterstraße zwischen Gebirge und Dickicht ein, wo er schließlich einen sicheren Platz fand und das Auto dicht an einem Berghang zum Stehen brachte.
Die beiden stiegen aus. Er war Winteranfang, die Sonne hatte dennoch Kraft, sie stand hoch genug und spendete ihnen Wärme. Kaiwan nahm Leylas Kopftuch ab und legte es auf ihre Schultern. „So ähnelst du meiner lieben Leyla“, sagte er.
Leylas Gesicht machte, wenn es auch mit einem Schleier von Trauer bedeckt war, der Sonne Konkurrenz. Im Gottesstaat dieser Männer war selbst die Sonne traurig. Kaiwan setzte sich in der Sonne auf einen Stein und forderte sie auf, sich neben ihn zu setzen. Sie legte ihren Kopf auf seine Schulter. Kaiwan nahm ihre Hände in seine und drückte sie so innig, als wolle er ihr auf diesem Wege sein ganzes Gefühl vermitteln. „Sag, Liebste, was kann ich für dich tun? Du tust mir so Leid, Leyla, ich kann es nicht ertragen, dich so angeschlagen zu sehen. Lach doch, Leyla, um Gottes willen, lache!“
Leyla weinte und seufzte. Sie hob seine linke Hand an ihre Lippen und küsste sie. Kaiwan sah sie an, ihr Gesicht war von Tränen übergossen. „Weine nicht, Leyla, um Gottes willen, weine nicht. Ich kann es nicht aushalten.“
Leyla lächelte ihn unter Tränen an. „Du tust mir so Leid, Kaiwan. Ich hätte vielleicht nicht bei dir anrufen sollen. Mich dem Schicksal stellen, jenem Schicksal, das sie mir schmieden.“
Kaiwan verstand nicht, was sie damit meinte. „Was meinst du, Liebste? Offen gestanden, verstehe ich nicht, was du meinst.“
Sie lächelte ihn wieder an. „Niemals werde ich mich diesen Leuten unterwerfen. Ich werde mich rächen! Das verspreche ich dir. Wenn wir auch für lange Zeit nichts voneinander hören werden oder uns auch niemals wieder sehen sollten. Ich verspreche es dir, wenn ich weiterlebe, werde ich dir eines Tages zumindest mitteilen, dass ich mein Versprechen gehalten habe. Aber jetzt brauche ich deine Hilfe. Mit deiner Hilfe kann ich mein Ziel leichter erreichen.“
Kaiwan schaute ihr ins Gesicht. „Sag, Liebste, was ich für dich tun kann.“
„Ich schäme mich, Kaiwan, ich weiß, aber ich muss es dir sagen.“
Sie fing wieder an zu weinen. Wimmernd brachte sie mit bebender Stimme hervor: „Es handelt sich um meine Jungfräulichkeit. Das muss ich wieder in Ordnung bringen. Sonst bin ich von Anfang an erledigt.“
Du lieber Gott, ging es Kaiwan durch den Kopf, daran hatte er nie gedacht. O Gott, wie tierisch sind die Menschen! Ich muss für diese scheußlichen Kerle das Jungfernhäutchen meiner lieben Leyla zusammennähen. Das kann ich nicht! Bei Gott, nein, ging es ihm durch den Kopf. Er fing an wie Leyla zu weinen. Fassungslos umarmte er Leyla und unter Tränen sagte er zu ihr: „Komm, ich verstecke dich, Leyla. Ich kann dich nicht in die Krallen dieses so genannten Menschen ausliefern, ...
© Glaré Verlag
![]() Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
![]()
 "Eine
hochdramatische Handlung..."
"Eine
hochdramatische Handlung..."
(ekz-Informationsdienst)
Der andere Orient 27
79 Seiten. 9,80 Euro.
ISBN 978-3-930761-63-0
Leseprobe:
Die junge Richterin der ersten Instanz, Maneh Davtjan, vertagte zum wiederholten Mal die öffentliche Verhandlung des Mordfalls, der in der Stadt Aufsehen erregt hatte, nahm einige der Schnellhefter mit den Ergebnissen der Voruntersuchung mit nach Hause – was sie nicht durfte –, um jede Tatsache, die Zeugenaussagen, jedes Wort des Täters zu erwägen und dadurch nicht nur den Wortsinn zu erfassen, sondern sich auch in die Psychologie hineinzuversetzen, in die Gefühle und die Logik zu vertiefen, die hinter jedem der ausgesprochenen Worte, die der Untersuchungsführer mit seiner teuflischen Handschrift niedergeschrieben hatte, zu vermuten waren. Obwohl sie erst seit einigen Jahren Richterin war, war sie recht erfahren und vermochte sich um der Gerechtigkeit willen über das Persönliche und Dinge, die besonders einer Frau seelisch nahe gehen, zu stellen.
Auf der bunten Bühne des Gerichts, wo es Menschen jeden Schlags und jeden Charakters gibt, achtete und schätzte man sie. Die Untergebenen taten das betont-demonstrativ und versuchten dadurch bewusst oder auch unbewusst ihr eigenes Ansehen zu verbessern, als wollten sie sagen: „Schaut her, wie gut wir sind! Wir wissen alles, was gut ist, gebührend zu schätzen.“ Zuweilen waren diese Leute ihr gegenüber von Neid und Missgunst erfüllt, war sie doch anders als sie, irgendwie eigen. Obwohl sie sehr feinfühlig war, bemerkte Maneh diese Missgunst nicht, weil ihr selbst jede Spur davon fehlte.
Immer wieder verliebte sich jemand in sie, sogar große Herren aus den höchsten gerichtlichen Instanzen; die Mutigen, die sich bis über beide Ohren in sie verknallten, gestanden ihr ihre Gefühle, in der Hoffnung, mindestens auf ein entferntes positives Echo zu stoßen. Es ging sogar das Gerücht um, selbst der Generalstaatsanwalt der Republik sei in sie verliebt, aber in einem Land, in dem in allen Ecken und Winkeln geklatscht und getratscht wurde, war das wohl kaum möglich, denn der Mann an der Spitze der dritten Gewalt würde sich einen solchen Luxus nicht erlauben. Aber wer weiß – in dieser Welt ist alles möglich, selbst die Präsidenten der Großmächte werden ihren Gattinnen bisweilen untreu und werfen sich heimlich in die Arme ihrer Sekretärinnen oder mancher Schauspielerin. Maneh lächelte sie dann sanft an, demonstrierte dabei mit ihren Augen ein gekünsteltes Staunen und schüttelte abweisend den Kopf. Durch die Ablehnung verwirrt, ging der Mann. Maneh erwartete es und erwartete es auch nicht, dass er wieder kommen würde. Aber nur wenige wagten es, den Versuch zu wiederholen. „Wie wenige wahre Männer gibt es unter diesen Männern!“, dachte Maneh. „Armes Volk! Wenn ich ein Mann wäre, würde Maneh mir gehören, auch gegen ihren Willen.“ Und ihr Herz und ihre Seele erlebten zuweilen heimlich stille Momente einer verletzten Weiblichkeit. Dieses Spiel war für sie lediglich interessant, sonst nichts, es war ihre Frauennatur; in der irdischen Wirklichkeit betrog sie ihren Mann, Physiker von Beruf, nie. Ihm widmete sie ihre ganze Liebe.
Es war bereits die vierte Nacht, in der sie wegen dieses Mordfalls nicht schlafen konnte. Ihr Mann Benjamin wachte gewöhnlich um Mitternacht kurz auf und sagte missmutig: „Dieser Mord wird dich noch umbringen, komm ins Bett!“
„Bitte, Ben …“, sagte Maneh, ohne von ihren Papieren aufzuschauen.
„Du liebst mich nicht.”
„Versündige dich nicht gegen Gott!”
„Wer ist denn das?“, fragte Ben eines nachts verschlafen und war auf einmal ganz wach.
„Er.“
Ben sah sich die Fotos des Mannes an, die sein Gesicht von vorn und von links und rechts zeigten, und sagte: „Ein klassischer armenischer Mörder.“
„Er sieht überhaupt nicht wie ein Mörder aus“, erwiderte Maneh. „Geh ins Bett!“
„Blutunterlaufene Augen …“
„Man hat ihn in der Untersuchungshaft brutal verprügelt.“
„Mach ihn bloß nicht zu einem gemarterten Christus!“
„Was …?“
„Ein fieser Kerl.“
Als Ben ins Schlafzimmer gegangen war, hörte Maneh auf, in der Akte zu lesen und schaute lange auf die Fotos des Mannes, besonders auf jenes, das ihn von vorn zeigte: feine Gesichtszüge und ein wehmütiger Blick, die Zeichen einer himmlischen Botschaft auf den Lippen, als wäre er doch fast Christus selbst. Aber ohne den Einwurf ihres Mannes hätte sie das Bild nicht so gesehen. Erst Ben hatte sie es so sehen lassen. Sie fuhr fort das Bild zu betrachten, als ihre Augen auf einmal in ein blendendes Licht getaucht wurden, ihr Herz zu flattern begann.
Was war das? Staunen? Fühlte sie sich plötzlich zu diesem Mann hingezogen? War es Bewunderung? Die Augen des Verbrechers mit dem rätselhaften Gesicht sahen nicht einfach vor sich hin, ihr Blick drang in ihr Herz. Maneh drehte das Bild um. Und sofort drehte sie es wieder zurück, um seinen lebendigen Atem zu spüren. Sie schloss die Augen und fuhr fort, auch mit geschlossenen Augen zu sehen. Noch einmal drehte sie das Quadrat aus rauem Papier um. Jetzt sah sie ihn deutlicher; sie fühlte, dass er dabei war, sie mit dem Reiz seines Geheimnisses gleichsam zu vereinnahmen, und sie erschrak bestürzt: Zog es etwa ihr Herz auf diese grüne Wiese mit den vielen Fragezeichen von Vereinnahmung, fast wie, ja fast wie Demütigung, Sklaverei?
Sie stand auf, ging ins Schlafzimmer, zog sich aus, stieg ins Bett und schmiegte sich fest an ihren schlafenden Mann, als suchte sie eine Erlösung von den Gefühlen, die sie bestürmten. Dass sie ihren Ben nicht verlöre! Dass Ben sie nicht verlöre, dass sie beide in dieser falschen und doppelzüngigen Welt einander nicht verlören!
Als sie aufwachte, war Ben nicht da und ihr fiel ein, dass er an diesem Morgen früher als sonst in sein Labor gehen musste. Sie blieb friedlich liegen, keine Einzelheit der nächtlichen Vision kam ihr in den Sinn, wie wenn nichts geschehen wäre; dafür erschien vor ihren Augen das lange Leben, das sie und Ben gemeinsam gelebt hatten, wie ein farbiges Bild. Sie waren sich in ihrer Studienzeit an der Universität näher gekommen, frei und offen hatten sie einander geliebt, sie hatten das Gefühl gehabt, nicht in einer konservativen Stadt zu sein, sondern durch das gestirnte Blau des Himmels zu fliegen und dabei den Neid und die Bewunderung der Menge zu erregen.
Maneh umschlang das Kissen ihres Mannes, atmete es gleichsam ein. Seliger Schlaf senkte sich auf ihre Lider. Im süßen Schoß dieses Schlafs durchdrang blitzartig ein Traum oder eine Vision ihre Seele und erhellte für einen Augenblick das Gesicht des Verbrechers. Sie schrak auf. Ihr Busen wogte. Ben war nicht da. Ruhe trat allmählich in ihr Herz ein: Auch der Mann auf dem Bild, der laut der Protokolle der Voruntersuchung den Liebhaber seiner Frau umgebracht hatte, war nicht da. Durch ihren Traum verwirrt, stieg sie langsam aus dem Bett, indem sie zuerst einen Fuß und dann den anderen auf den Boden setzte. Im Schlafzimmer waren zwei Frauen, sie selbst und eine andere, die der Spiegel der Frisierkommode reflektierte, mit nacktem Oberkörper, sie glich Maneh und wieder nicht, sie war sie und doch anders.
An diesem Tag nahm sie sich weniger wichtige Sachen vor. Zu Mittag ging sie ins Café – das Angebot der Sekretärin, im Gericht einen Kaffee zu trinken, lehnte sie ab – und beschloss die Gerichtsverhandlung erneut um zwei, drei Wochen aufzuschieben, um den Fall eingehender zu studieren. Maneh rief von ihrem Handy Ben an, aber er war nicht im Labor. In ihr Arbeitszimmer zurückgekehrt, las sie das maschinengeschriebene Ehescheidungsurteil vom Vortag und war zufrieden, dass sie der Klage der Ehefrau nicht stattgegeben hatte, allerdings ohne gewichtigen Grund. „Immer mehr Ehen werden geschieden“, dachte sie, als sie das Urteil unterschrieb, „gut, dass diese gerettet wurde.“
Sie rief wieder im Labor an, obwohl sie nicht wusste, was sie ihrem Mann sagen sollte, wenn er sich meldete. Kurz vor Feierabend änderte sie ihren Beschluss, die Prüfung des Mordfalls um eine so lange Frist zu verschieben, schickte amtliche Schreiben an die entsprechenden Instanzen sowie an den Leiter der Untersuchungshaftanstalt. Diesen forderte sie auf, den Täter unter strenger Bewachung zur angegebenen Zeit zur Verhandlung vorzuführen. Sie verspürte einen unwiderstehlichen inneren Wunsch, ihn möglichst bald zu sehen.
Ben interessierte sich nur selten für die Fälle seiner Frau, nicht anders erging es Maneh mit seiner Physik; sie beide verkehrten miteinander auf dem Feld des Geistes, wo das ganze Jahr die Blumen der Liebe blühten, sie konnten sich sogar die Bilder des Alltags ersparen, die die Menschen einengen und zu traurigen Kreaturen machen, die sich durchs Leben schleppen.
„Hast du deinen Christus gekreuzigt?“ Ben sah von der Zeitung auf, als seine Frau herein trat.
Ihr Herz erbebte von dieser unerwarteten Frage.
„Nächste Woche.“
„Du wirst dich also noch einige Tage mit ihm beschäftigen“, murrte er. „Kannst du dich nicht wenigstens heute Nacht mit mir beschäftigen?“
„Gut, Ben“, sagte sie, „heute Nacht wirst du gemartert.“
„Ich verliebe mich jeden Tag aufs Neue in dich.“
„Was gibt’s in den Zeitungen?“
„Neue Morde. Wir töten oder werden getötet, keine andere Lebensweise scheint mehr möglich zu sein, die Physik vermag das nicht zu begreifen. Sag du doch was! Warum ist das nur so?“
„Ich habe Angst, Ben.“
„Vor wem hast du Angst?“
„Vor mir selbst“, erwiderte sie.
Maneh sagte das mit einer so kalten Logik, dass auch Ben einen Augenblick lang von Angst gepackt war, aber er versuchte sie zu beruhigen.
„Diese Nacht werden wir keine Angst haben.“
„Martere du mich bitte, Ben!“
„Wir werden einander lieben und quälen!“, entgegnete Ben. „In der Physik wird das als das Gesetz der gegenseitigen Anziehung bezeichnet.“
„Was für ein wunderbares Gesetz!“ Maneh lächelte.
Diesen Abend und die ganze Nacht blieb sie vom Schreibtisch fern, auf dem die Schnellhefter mit der Unterlagen des Mordfalls lagen. Jedoch gab es in dieser Nacht einige Momente, wo sie in Gedanken heranging und einen Blick auf sein Foto warf, das ihn von vorn zeigte und die Gesichtszüge sowie das Wesen des Verbrechers aller Wahrscheinlichkeit nach wahrhaftiger wiedergab.
„Bring doch dieses Zeug aus unserem Haus weg!“, sagte Ben am Morgen, die schlaflose Nacht hatte ihn befriedigt und beglückt.
„Am Montag, Ben. Da hab ich die Sitzung.“
„Freitag, Samstag, Sonntag – noch drei Tage!“, zählte Ben.
„Nimm’s doch leicht!“
„Wie soll ich’s denn leicht nehmen, dass bei mir zu Haus, neben mir, ein Mörder ist, selbst wenn er das unschuldige Gesicht eines Christus hat!“
„In meinem Dienstzimmer im Gericht gehen so viele Leute ein und aus, ständig ruft jemand an, ich kann mich dort nicht konzentrieren. Das hier ist aber eine ernste Sache, ein Menschenschicksal, darum hab’ ich’s nach Haus gebracht“, versuchte Maneh sich zu rechtfertigen. Doch sie wollte damit eher die eigenen Zweifel zerstreuen, die sie quälten, da sie die Akten schon so lange zu Hause behielt. Hatte das etwa eine andere Ursache? Sie war sich dessen noch nicht ganz bewusst, es war eher ein dunkles, sonderbares, Angst machendes Gefühl.
„Halt ihn bloß für keinen Christus, um ihn freizusprechen! Alle Verbrecher spielen den Christus, du weißt besser als ich, dass es nur Theater ist“, sagte Ben. „Wenn wir einen Verbrecher freisprechen, werden wir selbst einer, darum gibt es in der Welt immer mehr Verbrecher und immer weniger unschuldige Menschen“, fuhr er fort. „Eines Tages wird die ganze Menschheit zu einem einzigen Verbrecher und wir werden nach dem wahren Sohn Gottes suchen und ihn nicht finden.“
Ben forderte sie wieder auf, die Akten aus dem Haus fortzuschaffen: „Je ferner sie von uns bleiben, umso besser.“
...
© Glaré Verlag
![]() Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
![]()
 M.H.
Allafi
M.H.
Allafi
Nalan
Ein Mensch ohne Gnade
Roman
Der andere Orient 28
162 Seiten.
14,90 Euro
ISBN 978-3-930761-68-5
"Allafi ... packt
ein ebenso irritierendes wie faszinierendes Thema an."
(ekz-Informationsdienst)
Leseprobe:
1
Als ich erfahren habe, dass sie gestorben ist, überkam mich mit einem Mal ein Gefühl, als wäre mein Gehirn festgefroren, ich war nicht mehr in der Lage, klar zu denken, mehrere Stunden war ich wie lahmgelegt. Ich hoffte nur, dass ich irgendwann wieder normal funktionieren würde. Aber das war eine grundlose Hoffnung. Denn ich funktionierte von diesem Tag an nicht mehr normal. Ob ich überhaupt jemals normal funktioniert habe, war die Frage, welche die Leute, die mich kannten oder die von mir gehört hatten, sich wahrscheinlich gestellt haben, oder genauer gesagt, gestellt haben müssten. Dass das Ableben einer Frau meine Lebensgeschichte so radikal, so brutal durcheinander bringen würde, dass es einen Schlusspunkt setzen würde, das hätte ich nicht im Traum geglaubt. Brutal daran war eigentlich die Tatsache, dass ich auf diese Weise erst erfuhr, wer ich war und wer ich bin, wofür ich stand und wofür ich stehe.
Und ich stand vor einem Haufen Missetaten, die ich bewusst oder unbewusst zustande gebracht hatte, jene Missetaten, die noch kurz vor jener Zeit, zu der meine Mutter ablebte, als meine stolzen, heroischen Taten galten. „Mutter, Mutter!“, habe ich gerufen. Nicht „liebe Mutter“, denn ich wusste und weiß immer noch nicht, was Liebe ist, obwohl alle angeblich lieb zu mir waren. Sie jedenfalls antwortete mir nicht, sie konnte mir nicht antworten, sie war leblos, wie ich bemerkte. Ich berührte sie mit der Hand, und sie war eiskalt. Komisch fand ich es – obwohl ich quasi ein Todesengel war, allerdings nicht in Gottes Auftrag, sondern auf eigene Faust und Verantwortung bzw. Verantwortungslosigkeit, je nach dem, wie man es sieht – als ich bemerkte, dass die Toten schrecklich kalt sind, kälter als mein Herz. Nun verstand ich, warum man mich hinter meinem Rücken als „kaltblütig“ bezeichnet hatte, ohne mich überhaupt zu kennen, nur meiner Missetaten wegen.
Mutter stand nicht mehr auf, sie wurde begraben, irgendwo auf einem Friedhof, ich war nicht dabei, ich wollte nicht dabei sein, ich hielt nicht viel von den Toten. Ja, die Toten … „Wer waren sie, wie waren sie? Waren sie auch so kalt, als sie verbrannten?“, fragte ich mich. Es war das erste Mal, dass ich mich im Zusammenhang mit den Toten etwas fragte. „Ach Gott, so viele Tote!“, rief ich aus. Aber die Mutter war doch lebendig, sie konnte gar nicht tot sein. Niemand ist tot, und schon gar nicht meine Mutter. Alle diese Erscheinungen sind nichts als billige Scherze. Man ist immer vom Leben bepackt, auch vom Leben oder dem so genannten Tod der anderen. „Nein, nein, Mutter kann nicht tot sein“, murmelte ich vor mich hin, oder ich sagte es laut, denn ich war in einen Zustand versetzt worden, in dem es für mich keinen Unterschied zwischen laut und leise gab, genauso wenig wie zwischen Mann und Frau, zwischen alt und jung, alle Menschen waren in meinen Augen tausende und abertausende Jahre alt, ich war wieder ein kleines Kind. „Nein, tausendmal nein, die Mutter ist nicht tot!“, schrie ich heraus, laut oder leise.
Ich musste zurückkehren, zu mir selbst. In meine Vergangenheit. Dieser Drang zur Rückkehr kam von selbst, ich hatte keinerlei Einfluss darauf. Die Vergangenheit, meine Vergangenheit, konnte nicht schön gewesen sein, sie war auch nicht schön, so mindestens werden die anderen es sehen. Entsetzlich war sie, werden sie sagen. Ich wurde ganz bis zum Ursprung zurück und noch einmal durch mein Leben hindurch getrieben. Ich spürte alles wieder, in jeder einzelnen Zelle meines Nervenkostüms. Ich fühlte alles, alles wieder, und zwar bewusst.
Ich fühlte ihre Brustwarze in meinem Mund. Ich saugte süße, warme Milch, ohne mich zu verschlucken. Ich biss zu und sie zuckte zusammen von dem stechenden Schmerz und zog instinktiv ihre Brustwarze aus meinem Mund. Ich verdrehte die Augen und bohrte meinen unschuldigen Blick in ihr Gesicht, in ihre riesigen Augen, in denen eine leichte Spur von Tränen zu erkennen war.
Sie lachte und ihre Gesichtszüge sagten zu mir: „Du Scheinheiliger“, und sie steckte ihre Brustwarze wieder in meinen Mund. Sie ging davon aus, dass ich noch hungrig war und sie ihre Milch in mich hineinpumpen musste. Ich spürte, wie sie es genoss, wenn ihre Milch in meinen Mund spritzte, es war für sie wie eine Art Orgasmus. Sie wollte dabei nicht durch meine Bisse gestört werden, sie wollte ihre Brüste so lange auspumpen, bis sie ganz trocken waren.
Sie ahnte nicht, dass ich das Beißen übte. Sie wusste nicht, dass ich dabei war zu üben, wie man seinen Lieben Schmerzen zufügt. Woher hätte sie wissen sollen, dass ich so gemein sein konnte? Als ich ihre Brustwarze abermals ausspuckte, ging sie davon aus, dass ich satt war. Ich war aber nicht satt, ich wollte sie nur daran hindern, durch mein Saugen einen freudigen Höhepunkt zu erreichen. Ich wusste, dass sie ihre restliche Milch mit Hilfe einer Milchpumpe abpumpen würde, sie war schrecklich fruchtbar und produzierte so viel Milch, dass sie damit mehrere Kinder hätte stillen können. Tatsächlich hatte sie ab und zu die Kinder der Nachbarinnen gestillt, insbesondere bot sie es jenen Müttern an, die selbst wenig oder gar keine Milch hatten. Von denen gab es jede Menge. In solchen Fällen war ich sauer. Manches Mal, wenn ich das Gefühl hatte, dass ein Kind zum Stillen zu ihr gebracht wurde, hörte ich einfach nicht auf zu saugen. Ich saugte hastig und maßlos, daraufhin musste ich mich erbrechen und danach schrie ich. Sie hielt mich dann wieder an ihre Brust, um mich quasi zweimal zu stillen, wegen meines vorgeblichen Hungers und meines Weinens. Trotz all dieser Dinge hob sie mich jedes Mal nach dem Stillen hoch und legte mich so über ihre Schulter, dass mein Kopf direkt an ihrem Hals lag. Dann kotzte ich eine große Portion schon leicht angesäuerter Milch in ihren Blusenkragen. Das war mein Dankeschön.
Sie ekelte sich nicht. Der säuerliche Geruch der erbrochenen Milch stach mich in die Augen. Ich fing an erbarmungslos zu weinen. So machte ich sie unruhig und ließ ihr keine Ruhe, sich zu säubern. Sie stand auf und lief, mich in den Armen haltend, hin und her, dabei massierte sie sanft meinen Rücken, bis ich mich beruhigt hatte, was ich ungern tat, aber ich hatte keine andere Wahl, es fiel mir nichts mehr ein, was ich anstellen konnte. So legte sie mich in mein Bett und verschwand schließlich im Bad, um sich in Ruhe zu säubern.
Ich hörte, wie das Plätschern des Wassers wieder verstummte. Dann kam sie ohne Bluse aus dem Bad. Kaum hatte sie eine neue Bluse angezogen, fing ich an zu schreien so laut ich konnte. Sie nahm mich wieder auf und rieb ihre Wange an meiner Wange, um mich zu besänftigen, sie summte sogar ein sanftes Kinderlied und flüsterte mir liebe Worte in die Ohren. Dann herrschte gespannte Stille. Ich vernahm das Hauchen ihrer Atemzüge, es war wie ein behagliches Dampfbad, und ich fühlte mich rundum wohl. Da nutzte ich die Gelegenheit und biss ihr in die Nase, womit sie überhaupt nicht gerechnet hatte. Sie zuckte zusammen und zog ihr Gesicht zurück. Tatsächlich schaffte ich es, ihre Nase leicht zu verletzen, zu mehr konnte ich in diesem Stadium meines Lebens noch keine Kraft aufbringen. Ihr Blick sagte: „Du brutaler Kerl“, und ich lachte wieder scheinheilig und sie verzieh mir. Ich war zufrieden mit mir.
Zu dieser Zeit hatte ich erst zwei Zähne. Wenn sie erzählte, was ich alles mit meinen zwei Zähnen anstellte, sagten die Verwandten und Nachbarn: „Gott bewahre, wenn er mehr Zähne hätte, würde er wahrscheinlich uns alle in Stücke reißen.“ Sie gingen davon aus, ich meine die Nachbarn und Verwandten, das sei ein Indiz dafür, dass ich später ein brutaler Mensch würde. Sie sagten es aber nicht zu meiner Mutter, um sie nicht zu beleidigen, denn es lag ihr völlig fern, ein brutales Kind in der Gesellschaft abzuliefern. Von dieser üblen Nachrede erfuhr ich erst, als meine Mutter mich einmal allein bei ihnen gelassen hatte. Sie gingen nämlich davon aus, dass ich nicht verstand, was sie über mich sagten. Schon damals ahnte ich, wie dumm die Menschen sein können, denn einerseits bescheinigten sie mir auf Grund meines besonderen Verhaltens einen brutalen Charakter, andererseits dachten sie, ich wäre wie alle anderen Babys.
Sie ahnten auch nicht, dass selbst die Geschichte dieser beiden Zähne eine qualvolle Geschichte war. Tage und Nächte litt ich Schmerzen und schrie, bis diese beiden Zähne gewachsen waren. Es war genau zu dieser Zeit, dass ich mir geschworen habe, mit diesen brutalen Zähnen diese Schmerzen an andere weiterzugeben. Die Zähne hatten sich durch mein zartes Zahnfleisch gebohrt, und ich benötigte auch weiches zartes Fleisch, um sie hineinzubohren – was wäre besser geeignet gewesen als die Brustwarzen einer Frau in diesem Stadium meines Lebens, zu dem ich gekommen war, ohne gefragt worden zu sein. Zumal ich damals nichts anderes als den Busen meiner Mutter zwischen die Zähne bekam. Später gab man mir zwar Plastik, um meine Beißgier zu befriedigen, aber ich bevorzugte weiterhin Menschen, genauer gesagt zog ich es vor, in Menschenfleisch zu beißen.
Mitten in der Nacht, wenn absolute Ruhe herrschte und alle tief schliefen, fing ich an, so laut ich konnte zu schreien. Meine Mutter rannte zu mir und steckte mir ihre Brustwarze in den Mund. Ich empfand dies als Versuch mich mundtot zu machen, mich zu erdrosseln. Ich konnte es nicht als Liebe und Fürsorge einstufen. So blieb mir nichts anderes übrig, als die Geschichte mit dem Beißen zu wiederholen. Der Unterschied zu dieser späten Stunde war nur, dass die Schmerzen, die ich ihr bereitete, ihr den Schlaf raubten. Wenn ich sicher war, dass sie diesen Zustand erreicht hatte, fiel ich in tiefen Schlaf. Auf diese Weise hielt ich sie lange wach. Das wiederholte sich fast jeden Abend, so wurde die Tat, die die anderen Missetat nannten, zu meiner Aufgabe. Meine Mutter sah infolgedessen immer angeschlagen aus, ihre Augen waren schrecklich rot und verquollen. Sie so ramponiert zu sehen, bereitete mir Freude. Wenn mal der Schlaf sie überwand, hatte ich das irgendwie im Gefühl und fing sofort wieder an zu schreien. Dann sang sie mir Lieder und erzählte mir Geschichten, in der Hoffnung, mich zu beruhigen, aber ich hörte ihr kein einziges Wort zu. Im Gegenteil grübelte ich nach, wie ich sie mit meinen wenigen Möglichkeiten weiter ärgern konnte. Denn ich fand es betrügerisch, was sie tat, ich konnte nicht hinnehmen, dass sie mich mit ihren Tricks zum Einschlafen bringen wollte.
Ich konnte auch hervorragend meine Ohren verschließen, das war ein weiteres Gelöbnis von mir. Denn auch diese Ohren hatten mir unerträgliche Schmerzen bereitet. Manche Nächte schrie ich dermaßen, dass meine verzweifelte Mutter die Nachbarn zu Hilfe rief. Als einmal sämtliche Frauen meinem Zustand gegenüber ratlos waren, blieb meiner Mutter nichts anderes übrig, als ihren Nachbarn Ali, den Opiumsüchtigen, herholen und ihn auf ihre Kosten einen Brocken Opium rauchen zu lassen, damit er mit dem Opiumqualm meine Ohren ausputzte und ich mich beruhigen würde. Aber ich ließ mich nicht beruhigen, bis Ali auf die Idee kam, mir ein kleines bisschen Opium auf die Zunge zu schmieren. Das betäubte meinen ganzen Köper einschließlich meiner Ohren, und Ali war aus zweierlei Gründen höchst zufrieden, denn zum einen war er kostenlos in den Genuss von so viel Opium gekommen und zum anderen wusste er, dass seine Behandlungsmethode noch mehr an Glaubwürdigkeit gewonnen hatte. Damit könnte er sowohl mehr Opium verkaufen als auch häufiger zu dieser Art Einladung kommen, wo er auf Kosten anderer das prächtige Opium paffen konnte. An diesem Tag hatte meine Mutter sich zu helfen gelernt, sie sorgte nun dafür, dass immer ein Stück Opium bei uns zu Hause vorhanden war. Wenn nur der geringste Verdacht bestand, dass die Ursache meiner Weinerei irgendwelche unvermeidlichen Schmerzen waren, wurde etwas Opium auf meine Zunge geschmiert...
...
10
Als Nalan und seine Familie in der Großstadt ankamen, dämmerte es gerade. Er hatte ein merkwürdiges Gefühl. Er war weder traurig noch froh. Er wollte nichts vermissen, von dem, was er hinter sich gelassen hatte, und wollte auch nichts entdecken von dem, was er vor sich hatte. Er war wie immer, wie bei jeder neuen Angelegenheit, teilnahmslos. Alles schien ihm egal zu sein und seine Familie meinte, er wäre noch klein und verstünde nichts. Aber er verstand sehr wohl alles, was vor sich ging. Seine Schwestern waren im Gegensatz zu ihm einerseits aus dem Häuschen und fanden den Umzug in die Stadt sehr aufregend, andererseits hatten sie Angst vor allem, was ihnen unbekannt war.
Die Mutter und die ältere Schwester waren mit einem anderen Auto gefahren, das wesentlich schneller war als der Lastwagen. Sie wollten früher dort sein, um das neue Zuhause gegebenenfalls etwas auszufegen. Die jüngere Schwester und Nalan waren mit dem Lastwagen auf dem Weg zu ihrem neuen Heim, sie saßen vorne neben dem Fahrer. Aus Langeweile schauten sie aus dem Fenster die Berge und Hügel und Täler an, oder sie betrachteten die unzähligen Autos, von denen sie überholt wurden. Es ging alles langsam voran, das alte Schrottauto konnte nicht schneller fahren. Gelegentlich rauchte der Fahrer eine Zigarette und jedes Mal wurde dabei Nalan und der Schwester übel. Sie konnten nur mit Mühe an sich halten, um nicht zu erbrechen. Das war die einzige Gemeinsamkeit, die die Geschwister teilten. Nalan hatte sonst mit niemandem etwas Gemeinsames. Er war verschlossen, schweigsam, autistisch. Er war quasi ein Einzelgänger, der sehr gut von den drei weiblichen Familienmitgliedern bemuttert wurde, und er genoss dies, dennoch ließ er sich von keiner von ihnen etwas vorschreiben. Ganz im Gegenteil, er kommandierte die Frauen gern herum, insbesondere die Schwestern. Ihnen gegenüber zeigte er niemals seine Zufriedenheit, er war immer der arme kleine Nalan, dem aus seiner Sicht etwas Besseres zustand.
Die Schwester, die ihn auf dieser Reise begleitete, hieß Roschanak, die Leuchtende, er nannte sie Roschi. Daraufhin riefen sie alle außer der Mutter, die ihre Kinder gerne mit vollem Namen ansprach, Roschi, was wörtlich keine Bedeutung hat, aber es gab einen Eseltreiber, dessen Dummheit in der Stadt jedem bekannt war, und dem man gerade wegen seiner Dummheit den Spitznamen Roschi gegeben hatte. Dies war so seit jenem Neujahrsfest, an dem er anlässlich der Feierlichkeiten eine Kerze auf dem Hintern eines Esels angezündet hatte, woraufhin der ganze Stall abbrannte und dem Brand neben dem Esel auch zwei Schafe zum Opfer fielen.
Roschi war zum Synonym für roschan geworden, was „hell“ bedeutet, denn es war Helligkeit, wofür der Eseltreiber am Neujahrsfest, dessen Symbol ebenfalls das Licht ist, auf diese dumme Weise hatte sorgen wollen. So gesehen war Roschi zum Symbol der Dummheit geworden. Solange sie noch klein war, machte ihr dieser Spitzname nicht viel aus. Aber als sie in die Schule kam, entdeckte sie den Sinn dieses Namens, insbesondere als die Kinder anfingen, sich über sie lustig zu machen. Sie erfuhr, was für ein armseliger Mensch dieser Roschi war, dessen Name sie ebenfalls trug. Einen Eselsanbeter nannten ihn die Menschen. Er lebte allein mit seiner alten Mutter, hatte keine richtige Arbeit, gelegentlich schuftete er als Lastträger, und seit sein Esel den Neujahrsfeierlichkeiten zum Opfer gefallen war, musste er die Lasten selbst auf dem Rücken tragen.
Seit dem Ableben seines Esels war es Roschis größter Wunsch, sich einen neuen Esel anzuschaffen. Manches Mal, wenn man ihn betrachtete, wie er den vorbeitrampelnden Eseln mit verklärtem Blick folgte, wie er ihnen mit Tränen in den Augen nachstarrte, bis sie wirklich ganz aus seinem Blickfeld verschwunden waren, konnte man ihm das ansehen. Er ging hin und wieder zu den Eseln der anderen, die im Schatten eines Baumes oder einer Mauer ruhten, beobachtete sie stundenlang und versuchte, seine Zuneigung zu ihnen zum Ausdruck zu bringen, indem er die Fliegen und Mücken, die sich an manchen Stellen der Eselskörper, insbesondere um den Afterbereich und die Augen ansammelten, fortscheuchte. Er trug auch die herumliegenden Grasreste zusammen und hielt sie liebevoll den Eseln vor das Maul. Er streichelte sie jedoch nicht, denn er wusste, dass diese Kreaturen bockig sind, dass sie manchmal keinen Spaß verstehen und plötzlich austreten. Er hatte das ein paar Mal bei seinem ehemaligen Esel erlebt, und das reichte ihm für das ganze Leben.
Im Frühling zog er in die Berge, wo er frische Kräuter sammelte, die er an den Händler verkaufte, doch diese Zeit dauerte nicht länger als vier Wochen, denn sobald es etwas wärmer wurde, wucherten die Kräuter rasant und waren für Menschen nicht mehr genießbar. Ab und zu schuftete er als Tagelöhner auf den Feldern, sonst lungerte er herum, und ohne den Lohn der Arbeit seiner Mutter, die als Haushaltshilfe, als Wäscherin für die anderen, Wohlhabenden schuftete, wäre das Leben für sie beide noch schwerer gewesen.
Roschi war also das Symbol alles Schlechten in dieser Stadt. Manche Gärtner warfen ihm sogar Obstdiebstahl vor, insbesondere wenn sie keinen anderen dafür fanden, dann fiel ihr Verdacht eben auf ihn. Darüber hinaus war er als Kleinkrimineller belastet, denn er hatte ein Kind, das irgendwann seinen Esel geärgert haben soll, mit dem Stock dermaßen verprügelt, dass es einen Schädelbruch erlitten hatte, doch da es wohlhabende Eltern hatte, wurde es rechtzeitig ins Krankenhaus in der nächsten Stadt gebracht und richtig behandelt. Ihm hatte das natürlich ein paar Monate Knast beschert.
Nalans jüngere Schwester hatte nun allen Grund, froh zu sein, denn in der Großstadt würde der Name Roschi seinen Sinn für immer verloren haben, niemand würde sie sich als Roschi vorstellen. Was bei der älteren Schwester nicht der Fall war. Die hieß Mahtab, „Mondschein“, und Nalan nannte sie Muschi, kleine Maus. Nun war sie fast erwachsen und wollte nicht mehr Muschi genannt werden. So kam es, dass Roschi und Muschi trotz ihres instinktiven Bemutterungsdrangs, der zum großen Teil durch die Mutter auf sie übertragen wurde, große Vorbehalte gegenüber Nalan hatten. Sie fühlten sich von diesem Knirps geknebelt, manches Mal wünschten sie sich wirklich, Nalan wäre tot. Gleich darauf plagte sie das schlechte Gewissen und sie haderten mit sich selbst. Irgendwie war dieser Typ der Mittelpunkt im Leben der drei Frauen, das Zentrum, um das sie rotierten und das ihrem Leben einen Sinn gab. Alles in allem waren sie jedoch froh, nun in eine relativ anonyme Stadt überzusiedeln. Die Schwestern waren fast sicher, dass es einige Zeit dauern würde, bis Nalan ihre verhassten Spitznamen unter die Menschen bringen würde. Vielleicht hatten sie Glück und fänden in der Zwischenzeit jede einen Mann, der sie aus dieser merkwürdigen Familie herausholen würde. Einen solchen Retter hatten sie bitter nötig, und sie hatten recht, der natürliche Retter war ein Mann. Was sonst?
Als Nalan und Roschi ankamen, erwarteten sie nicht Muschi und die Mutter allein, sondern auch ein Mann. Beim Anblick des Mannes erbebte Nalan tief in seinem Inneren. Den Mann kannte er. Es war als Fahrer für Lastwagen und Planierraupen bei der in der kleinen Stadt tätigen Straßenbaufirma beschäftigt, und er stand nun dicht an der Seite seiner Mutter. Das war eine böse Überraschung, mit so etwas hatte Nalan nicht gerechnet. Es schien, als sei die ältere Schwester auch sehr vertraut mit ihm. Er empfing Nalan und seine Schwester zwar freundlich, aber sehr dominant und väterlich. Nalans Distanz stand in seinem Gesicht geschrieben...
...
24
Nalan hatte mittlerweile unter verschiedenen Namen und Gesichtsmasken eine Reihe Beziehungen zu den verschiedenen kriminellen Gruppierungen, die in unterschiedlicher Weise mit gefälschten Papieren handelten, aufgebaut, er hatte mehrere Netzwerke installiert. Hierzu verfügte er über Dutzende Handys unter verschiedenen Namen. Er konnte alle Klingeltöne voneinander unterscheiden, für jede Bande, jede Art von Verbrechen hatte er einen eigenen Klingelton installiert. Auch nutzte er zum Informationsaustausch selbstverständlich die virtuelle Welt. Dort tauchte Nalan in unzähligen Personen, auf den verschiedensten Websites und in zahllosen Weblogs auf.
Er konnte nun alles liefern, Ausweise, Schulzeugnisse, Pässe, Urkunden jeglicher Art, auch staatliche Urkunden. Es kam häufig vor, dass mit seiner Hilfe nicht existierende Häuser und Grundstücke an mehrere Kunden verkauft wurden. Auch stellte er Zeugnisse von der Mittleren Reife über das Abitur bis zum Diplom aus. Er konnte Doktortitel je nach Wunsch von den Universitäten in Harvard und Oxford und von sämtlichen weiteren namhaften Universitäten im Ausland verleihen.
Auch den Staatsmännern war er in vielerlei Weise zu Diensten. Der eine oder andere Minister oder Präsident hatte von ihm seinen Doktortitel erhalten, der ihm den Weg zu seiner Karriere glättete, denn unter den Politikern war es Mode geworden, sich einen Universitätsabschluss und einen Doktortitel zuzulegen. Als einmal ein Minister durch seinen Konkurrenten im gegnerischen Lager an den Pranger gestellt wurde, der verlauten ließ, dass der angeblich von der englischen Oxford-Universität verliehene Doktortitel des Ministers gefälscht sei, und ihn öffentlich aufforderte, dazu Stellung zu nehmen, ließ Nalan den in Verdacht geratenen Träger des gefälschten Titels durch einen Mittelsmann wissen, dass in den Reihen seiner Gegner ein ganzes Dutzend Staatsbediensteter mit gefälschten Zeugnissen auf seiner Liste stünden. Er verriet diesem Minister ein paar Namen und ließ ihn wissen, dass er nur diese Namen in den Kreis seiner Gegner zu schleudern brauche, was dieser auch ohne zu zögern tat. Daraufhin kam wieder Ruhe in seinen Laden. Er konnte sich als Minister weiter mit dem Doktortitel schmücken, ohne deswegen behelligt zu werden. Im Gegenteil, seine Gegner brachten seinem Titel nun eine erhöhte Ehrfurcht entgegen.
Viele hatten auch mit Hilfe der von Nalan gefälschten Pässe und Visa das Land verlassen können. Niemand wusste, wie er hieß und wo er wohnte. Er selbst konnte in verschiedenen Gestalten auftauchen, indem er verschiedene Masken anlegte, die er selbst anfertigte, er war sozusagen legal und illegal, er war überall und nirgendwo. Irgendwie empfand er alle diese Dinge, die er tat, weiterhin als ein amüsantes Spiel. Seine Mutter war ihm gegenüber weiterhin still und sklavisch gehorsam. Die Schwestern waren nichts anderes als kleine Gehilfinnen, die er bei Bedarf zur Erfüllung bestimmter Aufträge nutzte, sie hatten manchmal die von ihm angefertigten Papiere zu einer bestimmten Uhrzeit an einem Treffpunkt, zum Beispiel in einer Telefonzelle, für die Kunden zu deponieren, in solchen Fällen ordnete er an, dass sie sich vollständig islamisch verschleierten. Denn die Enthüllung ihrer Identität hätte die Enthüllung seiner Identität bedeutet.
Es lief alles reibungslos. Als er seine kriminellen Netzwerke erfolgreich eingerichtet hatte, insbesondere seitdem er das Internet in Anspruch nahm, entließ er seine Schwestern von diesen Aufgaben. Nun hatte er wirklich Berge von Geld, und zwar nicht gefälschtes. Seine leiblichen Schwestern gehörten schließlich der besseren, feinen Gesellschaft an und waren bei Gott nicht mehr für solche Aufgaben geeignet. Dafür gab es tausende von anderen Schwestern und Brüdern, die bereit waren, gegen Geld alles für ihn zu tun und es auch weiterhin taten...
© Glaré Verlag
![]() Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
![]()
 Agapi Mkrtchian
Agapi Mkrtchian
An jenem
weißen Abend
Die Stimme
einer Armenierin
Poesie und Prosa
124 Seiten.
14,90 Euro
ISBN 978-3-930761-74-6
Leseprobe:
Als ich mit fliegenden Haaren und, wie immer, ein wenig verspätet eintrat, verstummten alle in dem moderat modern möblierten Raum und starrten mich gespannt an. „Ja, Mädchen, du bist wieder spät“, dröhnte die Stimme von Herrn Scharfsinn, unserem neuen Abteilungsleiter. Er hat so etwas gern... Er profitiert davon. Er wurde neulich befördert. „Er ist stets ein engagierter und wachsamer Mitarbeiter“, hieß es. Er kann mir mit seiner Wachsamkeit gestohlen bleiben.
„Mädchen, du bist spät!“ Ein stilles und schüchternes Mädchen war ich damals. Ich ging in die fünfte Klasse unserer Dorfschule, an der meine Eltern Lehrer waren. Eines Tages sagte meine Mutter zu mir: „Du wirst zu mir in meine Klasse wechseln. Das ist gut für dich.“ Ich widersprach ihr nicht. Es gab keinen Grund dafür, und außerdem war jede kleinste Veränderung im eintönigen Dorfleben eine willkommene Abwechslung.
Bald war es soweit, und ich stand vor der Tür meiner neuen Klasse. Die Stunde hatte schon begonnen. Etwas verunsichert klopfte ich an und öffnete die Tür. Eine Welle von neugierigen Blicken empfing mich, die Tochter der Lehrerin, und es wurde still, mucksmäuschenstill! „Mädchen, du bist spät, setz dich dorthin!“, sagte meine Mutter streng und zeigte auf die Bank in der ersten Reihe. Verlegen ging ich hin und setzte mich neben einen Jungen. Der aber saß, den Kopf über die Bank gebeugt, einfach nur da und schwieg. Auch in der nächsten Zeit sprachen wir nicht miteinander. Wochen oder Monate vergingen, ich weiß es nicht mehr genau. Ich hatte mich inzwischen an den Gedanken, neben einem Jungen zu sitzen, gewöhnt. Sehr bald wollte ich sogar neben ihm und nur neben ihm sitzen.
Ich erinnere mich auch nicht mehr daran, wer von uns beiden zuerst mit dem anderen gesprochen hat. Eines Tages, es war in der Pause, erklärte er mir eine Matheaufgabe. Dabei bewegte er energisch die Hände und den Kopf. Gebannt genoss ich den Klang seiner Stimme und verschlang jedes Wort von ihm, ohne irgendetwas zu verstehen. Plötzlich begegneten sich unsere Blicke und ich merkte, wie sein Gesicht vor meinen Augen verschwamm und mein Herz laut zu klopfen anfing. Ich wagte nicht mehr, ihn anzuschauen, ohne mir dabei etwas zu denken. Außerdem traute ich mich nicht, jemanden darüber zu befragen. So trug ich dieses für mich unerklärliche Gefühl viele Jahre in mir. Eines war mir allerdings klar: Ich wollte ihn sehen, jeden Tag, jede Stunde und jede Minute! Ich wollte seine Stimme hören und in seiner Nähe sein! Ich ging abends mit seinem Namen auf meinen Lippen ins Bett und stand morgens damit auf.
In den folgenden Jahren ereignete sich nicht viel. Die wenigen Möglichkeiten einer Begegnung mit ihm außerhalb der Schule waren selten, man sah sich höchstens zufällig auf dem Weg zu einem Verwandten, im einzigen Dorfladen oder im Bus, auf der Fahrt in die Hauptstadt. Wir sprachen dabei über Verschiedenes, über unsere Hobbys, über den neuesten Fernsehfilm, die Klassenkameraden und unsere Zukunftspläne nach dem Schulabschluss. Keiner von uns wagte jedoch mehr, ich wegen meiner Schüchternheit und er aus Respekt vor der Tochter seiner Klassenlehrerin. Zudem konnte die „öffentliche“ Unterhaltung eines erwachsenen Mädchens mit einem Jungen bereits als reichlicher Gesprächsstoff für die dörfliche Gerüchteküche dienen.
Es war im Winter. Wir hatten unser erstes Klassentreffen. Während des ganzen Abends waren wir zusammen und unterhielten uns ohne Ende. Dann begann die Musik zu spielen und alle tanzten. Er stand auf, gab mir liebevoll seine Hand und führte mich zur Tanzfläche. Er drückte mich vorsichtig an sich und wir ließen uns wortlos in der sanften Umarmung der Melodie wiegen. Ich nahm kaum etwas um mich herum wahr. Ich hörte nur, wie mein Herz schlug, und fühlte, wie meine Wangen vor Aufregung zu brennen anfingen. Ich wünschte mir so sehr, dass die Musik nie aufhören würde.
Später begleitete er mich nach Hause. Es war dunkel und die Straßen waren nicht beleuchtet. Er legte seinen Arm um meine Schultern und so gingen wir durch die schmalen Straßen. Keiner von uns sprach, nur ab und an spürte ich, wie er mit der Hand über meine Schulter streichelte. Nicht weit von meinem Haus blieben wir stehen. Der Himmel hatte seine tausend Laternen angezündet und strahlte vor Freude. Überall lag dichter Schnee und es war still um uns. Er stellte sich vor mich hin, nahm meine Hand, sah in meine Augen und wollte etwas sagen... Plötzlich überkam mich Panik, ich wollte nur noch weg von hier. Ich zog hastig meine Hand zurück und lief fort. Als ich mich kurz umdrehte, stand er immer noch da und lächelte.
Seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen. Er ging zur Armee, mehrere hundert Kilometer entfernt, ich begann mein Studium und ging anschließend ins Ausland. Nur über Dritte hörte ich manchmal von ihm. Mit der Zeit verloren sich unsere Spuren gänzlich, bis ich ihn vor einer Stunde zufällig, als ich aussteigen wollte, in der S-Bahn sah. Er war in seine Zeitungslektüre vertieft. Ich blieb stehen und fühlte mich wie gelähmt. In diesem Augenblick hob er den Kopf und schaute mich direkt an. Einige Minuten musterte er mich, die Augen weit geöffnet. Keiner von uns brachte es übers Herz, ein Wort zu sprechen. Dann aber stand er langsam auf, beugte sich zu mir, streichelte mein Gesicht und fragte: „Du, hier, Liebste?“ Seine Hände zitterten, seine trockenen Lippen bewegten sich, und ich hörte ihn immer wieder „Liebste, Liebste“ flüstern.
Als Ausdruck meiner tiefsten Dankbarkeit für den glücklichsten Moment meines Lebens berührte ich seine Wange. Meine Worte blieben mir im Halse stecken. Nur mit großer Mühe stammelte ich, dass ich mit meiner Tochter hierher umgezogen sei, weil ich eine neue Stelle gefunden hätte. Er wurde unruhig, schaute auf die Uhr und sagte: „Egal, dann eben mit dem nächsten!“ Die S-Bahn hielt an, er ergriff meine Hand und wir stiegen aus. Auf dem Bahnsteig sagte er: „Lass uns hier in ein Café gehen“, und zog mich außer Atem hinter sich her. Für Widerspruch blieb mir keine Zeit, aber das wollte ich sowieso nicht. Ich hatte nur noch einen einzigen Wunsch, seine Nähe zu spüren, seine Hand zu halten und mich von seiner unwiderstehlichen Kraft führen zu lassen, bis ans Ende der Welt sogar. Ich bemerkte nur die erstaunten Gesichter der Vorübergehenden, denen ich als Antwort mein verwirrtes Lächeln spendete.
Erst im Café kam ich zu mir. Das Café war nicht voll. Er setzte sich an meine rechte Seite und wir bestellten Cappuccino mit Sahne. „Dass ich dich sehen und in meine Arme schließen darf, dafür danke ich meinem, unserem Gott“, begann er und spielte dabei mit dem Kaffeelöffel. „Ich bin auf der Durchreise, ich fliege nach Kalifornien. Ich mache hier einen Zwischenstopp.“ Er rührte die ganze Zeit mit dem Kaffeelöffel in der Tasse und es klang wie ein Selbstgespräch: „Ja, ich muss nach Kalifornien, ich muss dorthin!“ Dabei betonte er das „Muss“ so, als habe er Angst, er könne mir zu viel von sich erzählen. Ich aber stellte ihm keine Fragen. Ich wollte es einfach nicht.
Wir schwiegen einige Minuten. Er hatte sich nicht sehr verändert, nur seine Haare zeigten mehr Silbergrau. Seine Stimme war noch anziehender und seine Hände waren noch zärtlicher. Ich schaute in seine Augen. Ich hätte ihn am liebsten umarmt, mich an seine Brust gedrückt und unaufhörlich in sein Ohr geflüstert, dass ich ihn die ganzen Jahre über vermisst und mich nach ihm gesehnt hätte, dass ich meine Liebe zu ihm immer in der Tiefe meines Herzens getragen hätte und dass ich ihn noch heute liebe.
Er hörte auf, mit dem Löffel zu rühren, trank nervös den Kaffee aus, sah panisch auf die Uhr, dann sprang er auf und sagte: „Mein Flugzeug geht bald, ich muss... Ich darf mich nicht verspäten.“
„Ich auch nicht“, murmelte ich leise.
Er schaute mich überrascht an, fragte aber nichts. Schweigend legte er das Geld für den Kaffee mit reichlich Trinkgeld auf den Tisch, nahm meine Hand und zog mich aus dem Café. An der S-Bahnstation angekommen, umarmten wir uns und blieben so lange stehen, wie lange, weiß ich nicht. Für mich stand die Zeit still. Ich hörte nichts um mich herum, nur das Pochen seines Herzens und sein aufgeregtes Ein- und Ausatmen. Die S-Bahn kam und zersägte mit ihrem Lärm unsere Zweisamkeit. Wir erschraken. Zum Abschied drückten wir einander noch einmal die Hände und ließen sie dann langsam los...
„Stimmt etwas mit Ihnen nicht? Ist alles in Ordnung?“, explodierte eine Stimme in meine Ohren hinein. Ich zuckte zusammen. Etwas verwirrt sah ich auf die Gesichter der Anwesenden im Raum. Dabei spürte ich die Last der vorwurfsvollen Blicke auf mir, die eine Antwort von mir verlangten. Aber was für eine Antwort konnte ich geben? Sollte ich wirklich erzählen, warum ich mich verspätet hatte? Sollte ich wirklich sagen, dass ich dem Mann begegnet war, der mir so viel bedeutete? Sollte ich wirklich erklären, dass ich alles dafür geben würde, um mein Leben an jenem weißen Abend, dort unter Tausenden von Laternen, neu anfangen zu können?
„Sie wirken so abwesend!“, unterbrach eine andere Frauenstimme die Stille, „ist Ihnen nicht gut?“
„Oh, doch, doch, es ist alles in Ordnung, in bester Ordnung!“, stotterte ich. „Es tut mir furchtbar Leid, dass ich so spät bin“, hörte ich meine Stimme. „Ich habe nicht auf die Uhr geachtet, ich saß... ja... und...“
In der hintersten Reihe hustete jemand. Nach Erkältung klang das nicht. „Ich bin spät, weil...“, ich suchte nach Worten, „...ich wollte mein Gedicht zu Ende schreiben. Es war für mich sehr wichtig, das Gedicht noch heute zu beenden, verstehen Sie? Sonst... ja... sonst kann man schnell den roten Faden verlieren. Und das ist sehr schlimm. Wenn einem der rote Faden verloren geht, dann ist es ein mühsamer und meist ein hoffnungsloser Kampf, ihn wiederzufinden.“
Ich griff langsam nach meiner Handtasche, öffnete sie, holte ein Blatt heraus und fing an, mein Gedicht laut vorzulesen. Meine Verwirrung und meine Aufregung verschwanden im Nu. Ich fühlte in mir so viel Kraft, wie nie zuvor. Und ich hatte kein schlechtes Gewissen mehr.
Im Raum wurde es still, mäuschenstill. Nur meine Stimme, erregt von den Worten, schwebte über den Köpfen der Anwesenden.
An jenem weißen Abend
standen wir verlegen voreinander
und schwiegen.
Nur der Wind, neugierig,
wachgeküsst von der Kälte,
tanzte verrückt um uns herum
und summte leise in unsere Ohren.
Wollte der Wind etwas sagen?
Oder vielleicht etwas fragen?
An jenem kalten Abend
hielten wir unsere Hände fest
und schwiegen.
Was spürtest du? Was bewegte dich?
Das habe ich nie erfahren.
Was spürte ich? Was wünschte ich?
Das hast du nie erfahren.
Eine atemlose Stille herrschte unter den Anwesenden. Alle starrten mich an, diesmal mit mitfühlenden und versöhnten Blicken. Ich ging zu meinem Platz und setzte mich hin.
© Glaré Verlag
![]() Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
![]()
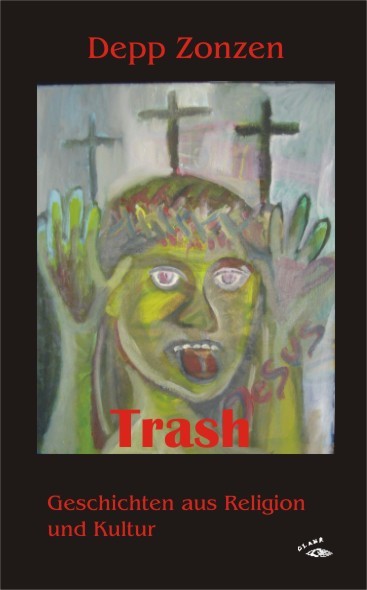 Depp
Zonzen
Depp
Zonzen
Trash
Geschichten aus Religion und Kultur
88 Seiten. 9,80 Euro
ISBN 978-3-930761-58-6
Leseprobe:
Zwei Wochen Ibiza. Die Zeit eine einzige Party. Mann, haben wir viel getrunken. Sangria und Bier aus Eimern. Und sonst: Mehr Frauen flachgelegt als in meinem übrigen Leben zusammen. Ich war stolz und ich war anerkannt bei meinen Freunden aus dem örtlichen Käferclub. Die gemeinsamen Ferien waren für mich die Generalprobe. Ferien, das hieß Kraft zu tanken. Ich war nun ein angesehenes Mitglied im Club und wir waren schon eine starke Gemeinschaft. Und da ich erst 16 war, hatte ich noch nicht einmal einen Führerschein.
Aber auch sonst lief es nicht schlecht in meinem Leben. Ich war glücklich, ausgefüllt, und ich hatte eine Lehrstelle. Kunststück bei meiner Begabung im Umgang mit Autos. Ja, eine Lehrstelle als Kfz-Mechaniker im Nachbardorf. Das ist nicht so selbstverständlich wie es klingen mag, denn in der Schule war ich eine Niete. Gerade vor den Ferien hatte ich die Hauptschule beendet. Mit mittelmäßigem Erfolg. Na, immerhin war meine Durchschnittsnote eine drei. Hierbei ist zu bemerken, dass ich das letzte Schuljahr wiederholt hatte. Das war auch nicht das einzige Schuljahr, das ich wiederholt hatte. Ich hatte meine Möglichkeiten in dieser Hinsicht voll ausgeschöpft. Die Schule war für mich in jedem Fall eine Tortur: Streber geärgert und erniedrigt, vor dem Unterricht die Hausaufgaben abgeschrieben und in den Pausen haben wir heimlich geraucht. So bekam ich Tadel um Tadel, doch einen Verweis zum Glück nie. Doch das hatte nun alles ein Ende.
Ach ja, wenn ich mich vorstellen darf: Mein Name ist Jorge Hansen. Ich lebe mit meinen Eltern, meinen zwei älteren Brüdern und mit meiner jüngeren Schwester auf einem Bauernhof in einem Dorf nahe der Schlei. Die Schlei liegt in Schleswig-Holstein, etwa zwischen Flensburg und Kiel. Mein Vater ist, wie unschwer zu erraten, Landwirt von Beruf. Meine beiden älteren Brüder tun es ihm gleich und packen somit auf dem Hof kräftig mit an. Der älteste Bruder wird, wenn mein Vater in Rente geht, den Hof übernehmen. Der zweitälteste will sich auf schulischem Wege noch fortbilden. Meine Schwester besucht zurzeit die örtliche Realschule.
Es war ein Montag im Juli. Am Sonnabend zuvor waren wir von Ibiza eingetroffen. Für die kommende Woche hatte ich meinen Eltern versprochen, auf dem Hof zu helfen. Mit gemischten Gefühlen war ich früh aufgestanden und ging nun in den Stall, um beim Melken zu helfen. Was würde der Tag wohl bringen? Ich fügte mich in den Alltag eines Landwirts ein. Nach dem Melken gab es Frühstück. Meine Mutter bat mich, ihr heute beim Einkauf im nächst größeren Dorf, in welchem sich auch meine Schule befand, behilflich zu sein.
Getränkekisten schleppen, da kam etwas auf mich zu. Ich willigte sofort ein. Ich war guter Dinge. So fuhren wir nach dem Frühstück los, Preise vergleichen. Wir liefen durch die Supermärkte. Meine Mutter hatte mich schon vorgewarnt, sie musste noch zum Friseur. Also machten wir eine Zeit ab und trennten uns dann. Ich schlenderte also los. Vorerst einmal zur nächsten Videothek. Wollte mein Wissen der neusten Filme auf den neusten Stand bringen. Ich kannte eine sehr gute Videothek. Sie lag etwas abseits und um zu ihr zu gelangen, musste ich am Amtshaus vorbei. Kaum am Amtshaus angelangt sah ich schon von weitem eine Menschenmenge. Viele hielten Spruchbänder in die Höhe. Ich musste lächeln, als ich all die engagierten Leute sah. Doch dann stockte mir doch ein wenig der Atem, mitten im Gewühl zwischen Ökos und Teesocken stand sie: Elisabeth Jensen.
Die Jensens haben ein Haus neben dem elterlichen Gehöft. Der Vater ist Architekt und ein beachtenswert tüchtiger Mann. Insgeheim war er immer ein Vorbild für mich. Einen wie ihn würde ich niemals erreichen. Ein Studierter. Und seine Tochter Elisabeth war ebenfalls ein Vorbild für mich. Sie hatte genau das gleiche Geburtsjahr wie ich. Als ich noch ein kleines Kind war, spielten wir oft gemeinsam Familie. Sie hatte sich ’rausgemacht, besuchte nun das Gymnasium in der Nachbarstadt. Und wie ich hörte, hatte sie einen Notendurchschnitt von 1,9. Das war beachtlich. Doch etwas haftete an ihr, worüber ich nicht hinwegsehen konnte. Sie war noch Jungfrau. Nicht dass dies etwas Besonderes war für ein 16-jähriges Mädchen, der Haken war nur, sie wollte auch Jungfrau bleiben bis zu ihrer Heirat. Wenn sie hässlich gewesen wäre, ja dann, aber das war sie ganz und gar nicht.
Nein, der Wind wehte aus einer ganz anderen Richtung. Elisabeth war Christin. Ich versteh nichts von Religion, nichts von Philosophie und ebenfalls nichts von Politik. War mir alles egal. Ich lebte mein Leben ganz einfach so wie es sich mir eröffnete. Ich ließ alles ganz ruhig auf mich zukommen. Schicksal, Karma und ganz besonders Gott, das interessierte mich nicht die Bohne.
Unter gewissen Vorbehalten kämpfte ich mich durch die Menge auf sie zu. Manchmal, da schaute ich auf ihre Brüste, sie tat dann so, als bemerkte sie es nicht. Jaja, sie hat schon ein großes Herz. Als ich bei ihr ankam, blickte sie mich schon freudig an. Wie immer roch sie sehr gut, sehr natürlich und ihr Aussehen war trotz Jeanshose sehr gepflegt. Die langen Haare waren an der Rückseite zu einem Zopf geflochten. „Was macht ihr hier?“, fragte ich sie. „Wir demonstrieren gegen die Jagd auf Wale“, sagte sie mir. Beinahe wäre mir eine dumme Bemerkung herausgerutscht, aber die verkniff ich mir. Das mochte ich an Elisabeth: Ich musste mir immer gut überlegen, was zu sagen war. Dann plauderten wir ein wenig über dies und das. Manchmal, da versuchte ich Elisabeth um den kleinen Finger zu wickeln. Bei anderen Frauen kam das sehr gut an. Sie aber blickte dann nur einmal kurz mitleidig auf. Ich verstand es nicht, viele Frauen flogen auf mich, auf meine Jugend, meinen Charme und auf mein kurz geschnittenes schwarzes Haar. Sie aber hatte vollkommen andere Prioritäten. Das brachte mich nicht selten in Verlegenheit, manchmal wurde ich sogar rot. Doch es war immer wieder von neuem eine Herausforderung für mich, mit ihr zu sprechen wenn ich sie mal traf. Und sie schien sich große Mühe zu geben, aber so war sie wohl zu allen. Dann, ich wollte mich gerade abwenden und mit einem „ich will nicht weiter stören“ davongehen, da zupfte sie mich noch einmal am Arm. Ich hielt inne. Und dann folgte eine Frage, mit der ich nicht gerechnet hatte: Sie wollte wissen, ob ich sie am Freitag zu ihrer Tante begleiten wollte. Ich überlegte kurz, willigte dann aber ein. Und so verabredeten wir uns für den kommenden Freitag. Dann verließ ich Elisabeth und die Menge und begab mich direkt zur Videothek.
Ich stöberte nach diesem und jenem Film und sah mir die Neueingänge an. Mit neuen Tipps verließ ich die Videothek und kehrte zum vereinbarten Treffpunkt zurück. Ich war noch zu früh und so ging ich direkt zu dem Friseur meiner Mutter. Ich betrat den Laden. Ich sah meine Mutter und zu meinem Entsetzen auch Sonja Müller. Mit Sonja Müller hatte ich vor längerer Zeit ein Nümmerchen auf dem Rücksitz des Wagens ihres Freundes geschoben, als dieser nicht ganz präsent war. Sonja arbeitete wohl in diesem Laden als Friseuse. Oh ja, sie sah mich und lächelte zu mir herüber. Verschämt lächelte ich zurück. Nein, diese Frau wollte ich nicht ohne Make-up und frisierte Haare sehen. Schrecklich stellte ich mir das vor. Ach, was musste ich betrunken gewesen sein.
Auf der Rückfahrt dachte ich an die Einladung von Elisabeth. Ich freute mich aufrichtig. Die Tage brachte ich auf dem Hof zu. Ich fütterte die Tiere, half bei der Ernte auf dem Feld, suchte Hühnereier auf dem Strohboden, stand morgens früh auf und ging abends früh ins Bett. Ausgefüllte Tage, und ehe ich mich versah, kam der Freitag.
Elisabeth holte mich nach Mittag an der Einfahrt zum Gehöft ab. Meine Mutter war erstaunt, als ich ihr erzählte, dass ich mit Elisabeth etwas unternehme. Aber sie freute sich auch. Mit den Nachbarn etwas zu unternehmen bedeutet ein gutes Verhältnis zu pflegen und das war nun mal sehr wichtig.
Gemeinsam mit Elisabeth ging ich zur nächsten Bushaltestelle und wir warteten auf den Bus. Während der Busfahrt erzählte mir Elisabeth von ihrer Tante. Es wäre eine Bereicherung, sie zu kennen. Das würde auch mir gut tun. Ich hörte wieder mal nur mit einem Ohr zu. Ich fragte mich gerade wieder, wozu eine Freundin gut sei, wenn man nicht mit ihr schlafen konnte, und dachte dabei natürlich an Elisabeth. Ansonsten blieb ich wortkarg. Sie dagegen schien sich zu amüsieren und schwärmte von der Tante. Dann, nach circa einer halben Stunde, fuhren wir in die nächst größere Kleinstadt ein, in welcher sich auch die Schule von Elisabeth befand.
Sie kommentierte, als wir an der Einfahrt zu ihrer Schule vorbei fuhren, und dann kam auch schon bald die Haltestelle, an der wir ausstiegen. Wir gingen in ein Siedlungsgebiet hinein und standen schon bald vor der besagten Hausnummer. Ein Etagenblock. „Habt ihr eure Tante abgeschoben?“, witzelte ich. „Sie ist sehr glücklich, du wirst schon sehen“, entgegnete Elisabeth. Wir klingelten. Nach kurzer Zeit öffnete ein Mann, der Pfleger. Elisabeth hatte von ihm erzählt. Er war etwa 190 cm groß und spindeldürr. Seine Haare waren schulterlang und hingen wild umher. Wir begrüßten ihn, er ließ uns in die Wohnung. Wir gingen durch einen kleinen Flur, direkt auf die Wohnstube zu.
Wir klopften an die Tür. Von innen ertönte eine kratzige Stimme. Sie forderte uns auf einzutreten. Und das taten wir dann auch. Erst Elisabeth, dann ich, dann der Pfleger. Der Pfleger, er hieß Georg, überholte uns und räumte dabei einen Stuhl beiseite, damit wir zur Tante vordringen konnten. Das Zimmer war groß und geräumig. Es mutete wie ein Museum an. Überall standen Vitrinen. Das Licht war ein wenig dunkel, dennoch staunte ich. Die alte Dame saß in einem mächtigen Sessel am Ende des Raumes. Sie empfing ihre Nichte im Sitzen mit offenen Armen. Sie umarmten sich. Eine rührende Szene, dachte ich bei mir. Dann stellte Elisabeth mich vor. Artig gab ich der Tante die Hand. Ich schätzte das Alter der Dame auf 60 Jahre. Ihre Haut war sonnengebräunt und schon ein wenig runzelig. Doch ihre Augen, die sehr groß waren, leuchteten.
Sie war in der Welt herumgekommen, hatte von ihrem Mann, der früh gestorben war, viel Geld geerbt und lebte eine zeitlang nur fürs Reisen. Nun war sie, von Gicht geplagt, nur noch selten unterwegs. Sie hatte die ganze Welt gesehen, davon zeugten auch ihre Mitbringsel im Raum. Weise sei die alte Dame, hatte mir Elisabeth verraten, was immer das auch heißen mochte. Sie kannte alle Religionen und Kulturen dieser Erde. Die Dame mit dem ergrauten Haar bat Elisabeth in dem Sessel vor sich Platz zu nehmen. Zu Georg gerichtet sagte sie: „Führe doch unseren Gast ein wenig im Raum umher und zeig ihm ein paar von meinen Andenken. Nachher gibt es dann noch Plätzchen und Kuchen“. Dann wendete sie sich Elisabeth zu, die sich ihr gegenüber hingesetzt hatte, und nahm ihre Hand. Georg wies mich an, ihm zu folgen und führte mich in den anderen Teil des Zimmers. Er zeigte mir Masken aus Afrika, Pfeil und Bogen aus Nordamerika, Schmuck aus Indonesien. Ab und zu blickte ich zu den beiden Frauen. Sie schienen sich prächtig zu unterhalten. Und ab und zu tuschelten sie ein wenig. Sie blickten dann zu uns herüber und lachten gemeinsam. „Frauen“, dachte ich bei mir und widmete mich wieder Georgs Erzählungen.
Etwas später gab es Tee oder Kaffee und Kuchen. Wir setzten uns gemeinsam an einen großen Tisch in der Mitte des Zimmers. Nun hatte auch ich Gelegenheit, einige Fragen an die Tante zu richten. Interessiert hörte sie zu und gab überlegte Antworten. Dann war es Zeit aufzubrechen. Wir verabschiedeten uns, reichten einander die Hände, erst der Tante dann Georg. Aber die Tante wollte mir noch etwas mit auf den Weg geben und flüsterte es Georg ins Ohr. Der sagte es mir als Elisabeth schon aus der Tür war. „Suche Wakan Tanka“, sagte er zu mir sehr geheimnisvoll.
Später dann im Bus fragte ich Elisabeth etwas irritiert, was sie denn mit ihrer Tante getuschelt hätte. Elisabeth fing an zu lachen. Sie sagte, sie hätte ihrer Tante erzählt, wie gottlos ich sei, worauf diese dann gelacht hätte. Und sie hätte dann noch darauf hingewiesen, dass die Wege des Herrn unergründlich seien. „Die Wege des Herrn sind unergründlich.“ Was sollte das heißen? Klar, ich hatte mich über Jesus Christus lustig gemacht. Unbefleckte Empfängnis. Ein Mann der nach seinem Tod zum Himmel schwebt. Ich konnte es nicht glauben. Intelligente Menschen, die man bewundert, und dann solch ein Humbug. Ja, ich werde mich auch in Zukunft über sie lustig machen; über sie und ihre Religion. War doch bisher alles glatt gelaufen in meinem Leben. Was konnte die alte Dame schon wissen, was ich nicht wusste?
Abends zog ich mir die Decke über den Kopf und wollte schlafen. Der Tag war anstrengend genug gewesen.
…
Es war Sonnabend. Am Wochenende durfte ich ausspannen. Ich brauchte nicht auf dem Hof helfen, durfte ausschlafen. Für Montag hatte ich Pläne. Ich würde meinen Vetter in Hamburg besuchen. Er hatte gerade einen Selbstmordversuch hinter sich und brauchte seelische Unterstützung. Mein Onkel hatte mich gebeten, dass ich mich doch einmal um ihn kümmern sollte. Jens war sein Name. Wir hatten uns das letzte Mal auf der Beerdigung meiner Großmutter vor anderthalb Jahren gesehen. Jetzt wäre es beinahe auch um ihn geschehen gewesen; Tabletten, eine Überdosis.
Das Wochenende war wie immer viel zu knapp und der Montag kam näher. Am Sonntagabend packte ich meine Taschen. Ich hatte geplant, wenn es Jens gut ging und die Chemie zwischen uns beiden stimmt, ca. zwei Wochen zu bleiben. Ich sah dem Besuch in Hamburg mit gemischten Gefühlen entgegen. In so einem Moloch von Großstadt musste ein labiler Mensch wie Jens ja untergehen. Aber er hatte es sich ja so ausgesucht. Wollte unbedingt in Hamburg leben. Er hatte sich für meinen Besuch Urlaub genommen. Jens bewohnte eine Zweizimmerwohnung in einem Stadtteil nahe dem Zentrum. Er liebte es am Puls der Zeit zu leben. Immer da, wo etwas los war, wo es etwas zu sehen gab. Mir dagegen würden die Dorfidylle und natürlich die Kameraden aus dem Club fehlen; die Ausfahrten über Land im Verband. Hier auf dem Dorf, da kannte und grüßte man alle und jeden. In der Stadt dagegen… Ich war ein „Landei“, wollte mit zuviel Trubel außer dem Altbekannten nichts zu tun haben. Nicht umsonst wurde ich im Club auch „Bauer“ genannt.
Aber ich hatte nun einmal zugesagt. Und andererseits war es eine willkommene Abwechslung. Ich begann mich mit dem Gedanken anzufreunden. Ich hatte noch ein wenig Erspartes vom Ibizaurlaub übrig. Selbstverdient, versteht sich. Anstatt Hausaufgaben zu machen, ging ich nachmittags in die Werkstatt und arbeitete für mein Geld. Dieses würde ich in Hamburg auch gut gebrauchen können.
Der Zug fuhr in den Hamburger Hauptbahnhof ein. Ich hatte während der Zugfahrt darüber nachgedacht, wie ich am besten auf Jens eingehen konnte. Ich wollte ihm ein wenig auf den Zahn fühlen. Was hatte es auf sich mit seinem Selbstmordversuch? Doch ich musste mit aller Vorsicht, das Ziel im Auge, vorgehen. Ich sah Jens auf dem Bahnhof schon von weitem und ich bekam einen kleinen Schreck. Seine Gesichtszüge wirkten eingefallen und er war leichenblass, sein Haupthaar war dünn geworden. Unterstrichen wurde der Eindruck allerdings von der ausnahmslos schwarzen Kleidung, die er trug.
Wir begrüßten uns. Jens, der drei Jahre älter war als ich, nahm mir eine Tasche ab. Gemeinsam gingen wir zur U-Bahn-Station. Ich löste eine Karte und dann fuhren wir einige Stationen. Wir redeten auf der Fahrt nicht viel, wir „beschnupperten“ uns ein wenig. Das Eis brach erst, als wir in der Wohnung waren. Ich erzählte Jens von meinem Abschlusszeugnis und der Lehrstelle, die ich antreten würde. Gespannt hörte er zu. „Und wie war es bei dir?“, fragte ich ihn. Er erzählte von seiner Arbeitsstelle. Jens war gut aufgelegt, fast ein wenig zu gut. Wie es mit seinem Freundeskreis aussah, wollte ich wissen, und dachte an meinen Club. „Alles in Ordnung“, sagte er und fügte hinzu, dass wir am morgigen Tag auf eine Party gehen könnten. Natürlich nur, wenn ich Lust hätte, aber es würde ihm sehr viel bedeuten. „Gern“, sagte ich und freute mich innerlich. „Was ist das für eine Party?“, fragte ich. „Eine Dark Wave Party“, entgegnete er. Was war das, Dark Wave?, fragte ich mich insgeheim. Doch ich wollte ihm nicht zu nahe treten, also schwieg ich.
Wir machten uns einen gemütlichen Abend. Eine Flasche Wein, Fladenbrot und Käse dazu. Etwas später wollten wir einen Film im Fernsehen gucken. Jens machte mich darauf aufmerksam, dass wir durchaus die Möglichkeit hätten, in der Zeit, in welcher ich da sei, auch ins Kino zu gehen. Ich freute mich über diese Aussicht. Bevor der Film begann kamen Nachrichten, die mich nicht interessierten, wie ich glaubte.
Doch dann war ich ganz Ohr. Es war von einer Walfangkommission die Rede, die hier in Hamburg tagte. Einem Mann galt ein besonderes Augenmerk, da er einige Staaten stark verurteilte und ihnen Vorwürfe machte. Ich dachte an Elisabeth. Aus diesem Anlass also die Demonstration. Wir schauten genüsslich den Film im Fernsehen, plauderten hinterher noch ausgiebig, machten ein Programm für den folgenden Tag und gingen dann zu Bett.
Um 10 Uhr am hereingebrochenen Tage stand ich unter der Dusche. Ich war bester Laune. Wir hatten viel vor am heutigen Tag. Wir begannen mit einem ausgiebigen Frühstück. Jens holte Brötchen vom Bäcker nebenan. Dann planten wir den Tag: Hafenrundfahrt, Fernsehturm und natürlich die Reeperbahn. Ich wollte alles sehen. Jens wies mich darauf hin, dass wir 14 Tage Zeit hätten und dass wir die Ruhe bewahren sollten. Ich stimmte ihm zu und zügelte meinen Enthusiasmus. So beschränkten wir uns an diesem Tag auf einen Stadtbummel und die Reeperbahn.
Als wir durch die Herbertstraße schlenderten, machte ich mir so meine Gedanken. Was waren das für Menschen, die Kunden bei den Damen waren, die sich hier anpriesen? Die Frauen waren zweifelsohne sehr hübsch, aber ich hielt ihre Kunden für arme Würmer. Wer hatte es schon nötig für Sex zu bezahlen? Ich hielt kurz inne, dann kam mir ein Gedanke. Ob Jens einer von diesen Leuten war? Mit was für einem Menschen ging ich nun eigentlich durch Hamburg? Ich wollte dieser Frage auf den Grund gehen, aber ganz in Ruhe.
Es nahte der Abend und ich war gespannt. Ich würde jetzt einen ersten Eindruck von Jens´ Wirkungskreis bekommen. Was ich sah, verschlug mir schon am Eingang des Clubs die Sprache. Was waren denn das für Verrückte? Ich hielt den Atem an. Jens war einer von ihnen. Ihm zum Gefallen und aus Neugier betrat ich das Haus. Was ich drinnen sah, übertraf meine kühnsten Erwartungen. Es war alles pechschwarz in dieser Disco, die Kleidung der Besucher ebenfalls. Irgendwie hatte ich das Gefühl, auf einem Maskenball gelandet zu sein. Alle hatten sich so sehr geschminkt und zurechtgemacht, dass sie wie verkleidet erschienen. War ich etwa bei einer Sekte gelandet? Das hätte mir gerade noch gefehlt! In was für Kreise war Jens da wohl hineingeraten, fragte ich mich. Mit der Weile sah ich, wie Jens immer mal wieder die Hand zum Gruß hob. Zweifelsohne, er kannte einige dieser Leute. Wir orientierten uns zur Theke hin und setzten uns auf die hohen Barhocker. Von hier aus hatten wir einen guten Überblick. Es war erstaunlich, wer alles zu dieser Party gekommen war. Da waren Hexen, da waren Feen, da kamen Grafen, und das Burgfräulein war auch gekommen. Gerade ging jemand an mir vorbei, der sein Gesicht leichenblass geschminkt hatte. Ich erinnerte mich an vereinzelte Gestalten, die bei uns ähnlich verkleidet auf dem Schulhof herumliefen. Das waren Freaks. Ich brachte kein Verständnis für diese Minderheiten auf, seien es nun Schwule, Lesben, seien es Christen oder Moslems. Für mich waren die alle gestört. Mir drängte sich eine spannende Frage auf: Hatte Jens einen Selbstmordversuch unternommen, weil er diese Menschen kannte, oder kannte er diese Menschen, weil er einen Selbstmordversuch unternommen hatte?
Ich bestellte mir ein Bier. Jens war beschäftigt. Er begrüßte hier ein paar Bekannte und begrüßte dort ein paar Freunde. Mal wurde er von dieser Gruppe von mir hinfort gezogen, mal von der anderen. Er entfernte sich im Verlauf des Abends immer weiter von mir. Er integrierte mich nicht in die Gespräche, stellte mich niemandem vor. Das hatte für mich verheerende Folgen. Ich bestellte mir immer mehr Bier. Die Situation wuchs mir über den Kopf. Ich bekam mit der Zeit einen beachtlichen Alkoholpegel, sah Jens immer seltener. So setzte ich mich einen Platz weiter und versuchte meinem Nebenmann ein Gespräch aufzuzwingen. Ich fragte ihn, ob er wisse, was denn das „Wankatanka“ sei. Er verneinte und wendete sich dann ab. In dieser Menge von außergewöhnlich gekleideten Menschen war ich mit Jeanshose und Lederjacke ein klarer Außenseiter. Ich wurde mir meiner Situation bewusst und bestellte noch mehr Bier. Von Jens war weit und breit nichts mehr zu sehen und ich begann mich langsam über die Leute lustig zu machen. Zuerst lachte ich sie nur offen an und aus, dann begann ich bei jedem, der sich an mir vorbeidrängte, einen Spruch loszulassen. „Hallo Dracula“, sagte ich jemandem ins Gesicht, der sich als Vampir zurechtgemacht hatte. Einen anderen wollte ich erschrecken. Ich schnellte von meinem Sitz empor und schrie ihm „Buh!“ ins Gesicht. Er war wenig beeindruckt, ich dagegen brach in heftiges Gelächter aus. Ich fand wenig Beachtung. Ich trieb es immer toller. Die Gäste auf dieser Party schienen von friedlicher Gesinnung zu sein. In unserer Dorfdisko hätte ich mir sicherlich schon Schläge eingefangen oder wäre hinausgeflogen, aber hier?
Langsam wandte ich mich wieder der Theke zu. Die Leute erschienen mir desinteressiert, bis mir ein junger Mann von hinten auf die Schulter tippte. Ich drehte mich um. Mein Gegenüber war cirka 30 Jahre alt und gut gekleidet, natürlich ausnahmslos in Schwarz. Seine Haare waren mit Pomade zurückgekämmt. Neugierig blickte ich ihn an. „Cleopatra möchte dich sehen“, sagte er. Sein Auftreten war kühl und distanziert.
Ich lächelte ihm entgegen. „Bin ich Julius Cäsar?“, entgegnete ich trotzig. Sollte ihre Hoheit doch zu mir kommen, dachte ich bei mir. Mein Gegenüber blickte mich abschätzend an, dann drehte er sich um und verschwand in der Menge. Auch ich drehte mich um. Es dauerte nur etwa fünf Minuten, da packte mich jemand von hinten an den Schultern. Mit aller Wucht wurde ich von meinem Barhocker und mitten durch den Saal gezogen. Vor einer Seitennische wurde ich auf die Beine gestellt. Ich blickte mich um, wollte wissen, wie mir geschah. Der Mensch, der mich durch den Saal gezogen hatte, war ein Koloss von einem Mann. Er war glatt zwei Meter hoch und doppelt so breit wie ich selbst. Kleinlaut und trotzig blickte ich zu ihm empor. Stumm zeigte er auf eine Frau, die in der Nische saß. Sie war etwa 30 Jahre alt, hatte schwarze lange Haare und ein scharlachrotes Samtkleid mit schwarzen Rüschen an. Das Kleid war ein Farbfleck unter den ganzen Schwarzgewandeten. „Leiste uns doch ein wenig Gesellschaft“, sagte sie freundlich lächelnd.
Sie bot mir einen Stuhl an. Es war sinnlos die Flucht zu ergreifen, denn der Koloss passte auf. Schweigend saßen wir uns gegenüber. Ab und zu blickte sie mich lächelnd an. Ich entspannte mich ein wenig, blieb aber kleinlaut. Der Mann mit der Pomade in den Haaren gesellte sich zu uns. Die Frau, die sich Cleopatra nannte, flüsterte ihm etwas ins Ohr. Darauf erhob er sich wieder und verschwand in der Menge. Kurze Zeit später stand er abermals an meiner Seite und dann sah ich neben ihm meinen Vetter. Die beiden schienen sich zu unterhalten, blickten dabei immer wieder zu mir herüber. Ich wollte aufstehen, doch der Koloss ließ mich nicht. Dann grüßte mein Vetter zu mir herüber, lächelte und ging davon. Trotz Alkohol kehrte ich in mich. Ich verstand die Welt nicht mehr. Nach einer halben Stunde sittsamen Schweigens erhob sich die Dame, die sich Cleopatra nannte. „Wir wollen gehen“, sagte sie.
Der Mann mit der Pomade in den Haaren und der Koloss erhoben sich ebenfalls. Ich war erleichtert. Gleich würde meine Gefangenschaft ein Ende haben. Aber da täuschte ich mich, denn der Koloss zog auch mich in den Stand. Sie setzten sich und mich in Bewegung. Langsam wurde ich unruhig. Wollten sie sich vor der Tür von mir verabschieden? Wollten sie mir noch eine Standpauke halten? Ich wusste nicht, was ich denken sollte. Was hatte der Pomadige mit meinem Vetter besprochen? Und dann, wir waren kurz vor dem Ausgang, geriet ich in Panik. Ich suchte einen Fluchtweg in die Menge zurück, aber das Riesenbaby war schneller. Er hielt mich fest. Ich wollte mich losreißen, fing an zu zappeln. Doch er trug mich eher schlecht als recht aus der Disco hinaus. Was hätte es für einen Zweck gehabt zu schreien? Die steckten doch alle unter einer Decke.
Der Pomadige hatte inzwischen einen Wagen vorgefahren. Einen schwarzen Kombi, keinen gewöhnlichen, wie ich sah. Es war ein Leichenwagen. Zünftig mit Gardinen vor den hinteren Scheiben. Cleopatra setzte sich auf den Beifahrersitz, der Koloss zwängte mich auf die Rückbank und setzte sich dann neben mich. Zweifelsohne: Sie wollten mich mitnehmen. Eine klare Entführung. Wir fuhren los durch die Stadt. Ich konnte mir den Weg unmöglich merken.
Nach 20 Minuten waren wir am Ziel. Wir hielten auf dem Hof einer Altbauvilla. Der Koloss zerrte mich aus dem Auto. Ich trat ihm mit aller Kraft gegen das Schienbein. Er lächelte mich an und wir setzten uns dann in Bewegung Richtung Eingangstür. Die anderen zwei folgten. Der Pomadige schloss die Tür auf. Wir betraten das Haus. Während Cleopatra und der Pomadige rechts vom Eingangsflur in einem Zimmer verschwanden, brachte mich der Koloss durch den Flur, besser gesagt eine Halle, so erschien es mir, bis zu einer Treppe. Er schaltete das Licht ein und führte mich die Treppe hinunter. Überall standen alte Ritterrüstungen. Ich war jetzt die Ruhe selbst. Ich redete mir ein, dass sie mit meinem Vetter eine Vereinbarung getroffen hatten. Er könnte, wenn es Not tat, die Entführer identifizieren. Der Koloss brachte mich zu einem dunklen Raum. Er gab mir einen Schubs in den Raum hinein und verriegelte dann von außen die Tür.
Ich suchte mir in der Ecke neben der Tür ein Plätzchen zum Liegen. Es war stockfinster in dem Raum und es war nicht mein Verlangen im Dunkeln auf Erkundungstour zu gehen. Ich döste vor mich hin und dachte über den heutigen Abend nach. Klar, es war wohl meine Schuld gewesen, dass diese Bande auf mich aufmerksam wurde. Ich hatte einfach keinerlei Verständnis und jetzt meldete sich meine Blase. Ich klopfte an die Tür. Der Koloss war sofort da. Er öffnete ein Fenster in der Tür und schaltete das Licht ein. Das hätte er schon früher tun können, dachte ich bei mir. Ich blickte mich im Zimmer um. Hatte direkt vor einer Couch gelegen. An der Wand befanden sich eine Dusche und ein Klo. Recht komfortabel, diese Gefängniszelle.
„Was willst du?“, fragte der Koloss. „Ich muss pinkeln!“, entgegnete ich. Ich tat es und bevor der Koloss das Licht wieder ausschaltete, raste ich zu der Couch. Dann schaltete er das Licht wieder aus. Ich schlief meinen Rausch aus. Irgendwann, es musste der nächste Morgen sein, wurde das Licht angeschaltet und mir wurde etwas zu essen durch die Tür geschoben. Dann passierte eine lange Zeit wieder nichts. Ich langweilte mich, fragte mich, was sie mit mir vorhätten. Wie lange würden sie mich hier festhalten? Die Zeit arbeitete gegen mich, war ein Teil der Marter, das Ungewisse. War ich in der Gefangenschaft von Sadisten? Bei diesen Freaks musste ich auf das Schlimmste gefasst sein. Nach einer langen Zeit öffnete der Koloss die Tür.
Ich trat in den Flur hinaus. „Wir gehen jetzt gleich nach oben“, sagte der Koloss. „Doch zuvor möchte ich dir noch eine Geschichte erzählen: Die Frau Cleopatra hatte einen Onkel. Sie war noch sehr jung, etwa 10 Jahre, und dieser Onkel missbrauchte sie. Und als die Frau Cleopatra älter wurde und an Einfluss gewann, da verschwand der Onkel eines Tages auf mysteriöse Art und Weise. Und die Moral von der Geschicht: Sei sehr nett zu Frau Cleopatra.“ Er sagte wirklich „Frau“ Cleopatra. Das war mir schon eine lustige Gesellschaft, erst nahmen sie mich gefangen und dann baten sie mich nett zu ihnen zu sein. Ich konnte es nicht fassen.
Wir gingen die Treppe hoch durch die Halle und dann führte mich der Koloss noch ein Stockwerk höher. Vor einer hohen Tür blieben wir stehen. Der Koloss klopfte an die Tür und öffnete sie. Wir traten ein. Mein Blick fiel sofort auf das Himmelbett am Ende des Raumes. Darauf lag die Dame Cleopatra. Der Pomadige saß auf der rechten Seite in einem Sessel und vor dem Bett stand ein dritter Mann. Er trug ein Tablett und einen Mittelscheitel. Er stand kerzengerade, die Nase zum Himmel gereckt. Das musste der Butler des Vereins sein. Der Koloss stupste mich näher zum Bett hin. Die Dame Cleopatra trug einen verführerischen Morgenmantel, halbdurchsichtig. Ich wollte nicht so gierig zu ihr hinstarren, doch sie befahl mir mich zu setzen. Dann befahl sie dem Butler die Getränke auf den Nachtschrank zu stellen und schickte die drei anderen Männer aus dem Raum. Mir war mulmig zumute. Durch ihren Morgenmantel konnte ich ihre Rundungen sehen. Sie packte mich am Kragen und sagte, dass ich ihr Lustsklave sei. Dann zog sie mich langsam aus. Erwartungsvoll ließ ich es geschehen. Als ich entblößt vor ihr saß, streifte sie ihren Morgenmantel ab. Ich sah, dass ihre Schamhaare abrasiert waren. Das schreckte mich ein wenig ab. Aber dann zog sie mich an sich und streichelte mich zärtlich.
…
© Glaré Verlag
![]() Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
![]()
 Olaf
Hagedorn
Olaf
Hagedorn
Von der Würde
Neue Gedichte
145
Seiten. 14,90 Euro
ISBN 978-3-930761-67-8
Leseprobe:
Ein Land
in dem es mir
gut geht
ein System
das mich
nicht unterdrückt
ein Land
in dem
Menschen leben
die nach
Freiheit schreien
ein Land
ohne Gewalt
und Demütigung
* * *
Freiheit
nach der ich schrei
ein System
in dem es sich
leben lässt
Vertrauen
in die haben
zu können
die uns regieren
Freiheit
die auch andere
Lebensformen toleriert
ein System
in dem Menschen
einander vertrauen
wo der Sozialismus
nicht durch eine Stasi
verraten wird
* * *
Ein Gedanke
eine Tat
ein Wiedersehen
nach langer Zeit
ein Wort
ein Blick
welcher alles sagt
Zurückbesinnen
ein Lied
aus der Ewigkeit
fortgehen
ohne ein Wort
die Traurigkeit
bis in die Gegenwart
* * *
Schichtübergreifend
Ausnahmezustand
Warnsignale
Seele zersprungen
überlaufende Gefühle
Verliebtheit
nicht bei allen
Gottesanbeter
Weltbefreier
nicht bei allen
Wahnsinnige Gedanken
verlorene Realität
unüberbrückbare Hürden
Gedanken, die den
Wahnsinn tragen
* * *
Du schenkst
ein Lächeln
aus dem Herzen
du gibst die Hand
dem, der ohne Brot
du legst einen Groschen
dem Straßenmusiker
in den Hut
Deine Träne
wegen der Ungerechtigkeit
das Brot
zum Verschenken
der Bettler
mit einer Flasche Bier
der Straßenmusiker
um in der Einkaufsstraße
Passanten zu erfreuen
* * *
Wenn ich schreibe
für den Frieden
wenn ich erzähle
eine Geschichte
die von Leid spricht
vom Krieg
der alles zerstört
Wenn ich schreibe
eine Zeile voll
wenn dir Liebe
und Gerechtigkeit widerfährt
eine Zeile
die voller Hoffnung ist
Wenn ich sage
dass nicht alles verloren
der Krieg, das Leid
das alles zerstört
wenn der Friede
endlich inne hält
* * *
© Glaré Verlag
![]() Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
Hier können Sie Ihre Bestellung aufgeben
![]()